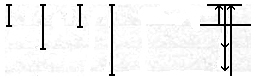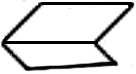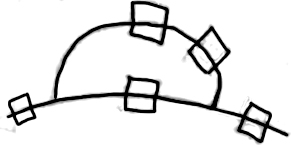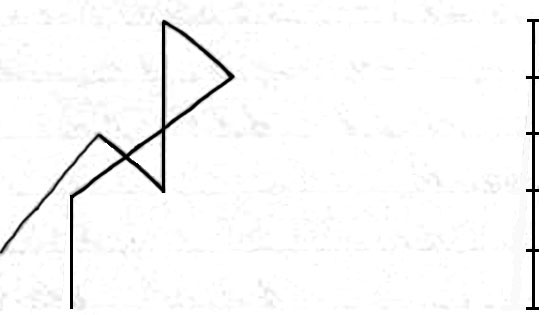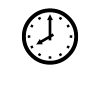| | | | | |
VI.
Philosophische
Bemerkungen
| | |
| | | / | | |
10.12.
1 Alles was ich in der Sprache tun kann ist
etwas sagen: das eine sagen.
(Das eine sagen im Raume dessen was ich hätte sagen
können.)
| | |
| | | ? / ∫ | | |
Man könnte das auch so
: Die Sprache
relativ & nicht absolut.
| | |
| | | / | | |
Wenn ein Satz nicht eine
mögliche Bildung unter anderen wäre, so hätte er keine
Funktion.
| | |
| | | / | | |
D.h.: wenn ein
Satz nicht das einer Entscheidung
wäre, hätte er nichts zu sagen.
| | |
| | | / | | | Der Beweis der
Widerspruchsfreiheit der Axiome
den die Mathematiker heute
so einen Sums machen. Ich habe das Gefühl: wenn
in den Axiomen eines Systems ein Widerspruch wäre so
wäre das gar nicht so ein großes Unglück.
Nichts leichter als ihn zu beseitigen.
| | |
| | | ∫ | | | Ein Satz kann eben
nur eines sagen
(an einen Ort des Raumes
deuten.).
| | |
| | | ∫ | | |
11.
Das Erste was wir vom Gedanken aussagen
möchten ist, er sei eine Tätigkeit.
Ein Vergleich der sich uns sofort aufdrängt ist der mit der
Verdauung.
Dann sagen wir, daß uns
der
Prozess, welcher Art er auch sein mag nicht
als typisch menschlicher oder organischer (oder als
Vorgang in einem Lebewesen)
interessiesiert.
Er
interessiert uns nicht als spezifisch physiologischer und auch nicht
als spezifisch psychologischer
(Vorgang).
| | |
| | | ∫ | | | Das Nächste ist der
Vergleich mit dem Chemiker den die Vorgänge im menschlichen Darm
auch nicht als solche interessieren sondern als chemische
Vorgänge die ebensogut in einer Proberöhre stattfinden
können.
| | |
| | | / | | |
Wir sagen: Für uns gibt
es nicht wesentlich außere &
innere Vorgänge (Jeder Vo⌊r⌋gang ist in
gewissem Sinne ein äußerer Vorgang)
Wir werden das Denken untersuchen als ob
es von dem Standpunkt, daß es auch von einer Maschine
ausgeführt werden könnte.
Aber hier
befinden wir uns in einer gänzlich falschen
Betrachtungsweise. Wir sehen das Denken für
einen Vorgang wie das Schreiben an oder das Weben als wäre es das
Erzeugen eines Produkts, des Gedankens, wie das Weben das
Erzeugen eines Stoffes etc. Und dann
läßt sich natürlich sagen daß dieser Vorgang der
Erzeugung im Wesentlichen auch maschinell
muß deuten lassen. Aber hier ist unsere
Auffassung ganz falsch. Das Denken interessiert uns
nur sofern es uns unmittelbar ist. Es ist ein Vorgang
nur im unmittelbar Gegebenen.
| | |
| | | / | | | Von einem
Product & etwas das es hervorbringt ist
für uns überhaupt keine Rede
| | |
| | | ∫ | | | Weder der Organismus noch die
Maschine ist ein Vergleichsobject.
Denn uns interessiert nichts was wir noch nicht
wissen.
| | |
| | | / | | |
Schon die Bezeichnung Tätigkeit für's Denken
ist in einer Weise irreführend. Wir sagen: das
Reden ist eine Tätigkeit unseres Mundes. Denn wir
sehen dabei unseren Mund sich bewegen ◇ &
fühlen es
etc. In
Sinne kann man nicht sagen das Denken
sei eine Tätigkeit unseres Gehirns.
| | |
| | | / | | | Und kann man sagen das
T Denken sei eine
Tatigkeit des Mundes oder des
Kehlkopfs oder der Hände? (etwa wenn
wir schreibend denken)?
| | |
| | | / | | |
Zu sagen [d|D]enken sei eben
eine Tätigkeit des Geistes wie [s|S]prechen des Mundes
ist eine Travestie ˇder Wahrheit.
| | |
| | | | | | Wir gebrauchen eben ein Bild, wenn wir von der
Tätigkeit des Geistes reden.
| | |
| | | ? ∫ | | | Das Denken
ist nicht mit dem Arbeiten eines Mechanismus zu
vergleichen den wir von außen sehen in dessen Inneres wir
aber blicken mü[ß|ss]en um seine Tätigkeit zu
verstehen.
| | |
| | | / | | |
Das Denken ist nicht mit der
Tätigkeit eines Mechanismus zu vergleichen der wir von außen zuschauen
die wir von
außen sehen |
deren Inneres
wir aber sehen um
sie zu verstehen.
| | |
| | | ? ∫ | | |
Das Denken ist nicht die
Tätigkeit eines Mechanismus, der wir von außen
zusehen deren [i|I]nneres aber erforscht werden
muß.
| | |
| | | ? ∫ | | |
Das Denken ist nicht mit der
Tätigkeit eines Mechanismus zu vergleichen den wir
von außen sehen in dessen Inneres wir aber erst dringen
müssen.
| | |
| | | | | | Denn was
uns ◇ am Denken nicht bewußt
wäre, gehört nicht dazu.
| | |
| | | / | | | Im Denken wird
nicht etwas in einem abgeschlossenen Raum verdaut.
| | |
| | | ∫ | | | Das Denken ist ganz
dem zeichnen von Bildern zu vergleichen.
| | |
| | | / | | | Man kann
aber auch sagen: Das Denken ist (wesentlich) mit
keinem Vorgang zu vergleichen & was wie ein
Vergleichsobject scheint ist in Wirklichkeit ein
.
| | |
| | | ∫ | | |
12.
Die Deutung eines Bildes nach der
Wirklichkeit ist schon eine Anwendung des Bildes.
| | |
| | | ∫ | | | Die Anwendung
des Bildes besteht immer in einer Übersetzung.
| | |
| | | / | | | Der Vorgang der
Übersetzung – etwa des Spielens nach Noten – wird durch
die Worte beschrieben: Er, ( der
[ü|Ü]bersetzende, richtet sich nach den
Noten.
Ist das nun die eigentliche, rein
sachliche Beschreibung des Vorgangs oder ist in sie schon ein Bild
(Gleichnis) hineingetragen (gleichsam ein
Anthropomorphismus)?
| | |
| | | / | | |
Er richtet sich nach den Noten heißt
vor allem nicht, daß er „richtig” spielt.
Wohl aber beschreibt es seine Absicht.
| | |
| | | / | | | Zu sagen
„Er hat die Absicht dieses Stück zu
spielen” (wobei man auf die Noten zeigt) hat gar keinen
Sinn wenn nicht eine Projectionsregel
vorausgesetzt ist[,|.]
[d|D]enn
sonst ist jede T Folge von Tönen oder keine
dieses Stück.
| | |
| | | ∫ | | |
Ich lese in
Lessing:
(über die Bibel)
„Setzt hierzu noch die
Einkl⌊e⌋idung und den Stil … … bald plan &
einfältig, bald poetisch, durchaus voll Tautologien,
aber solchen, die den Scharfsinn üben, indem sie bald etwas anderes
zu sagen scheinen, und doch das nämliche sagen, bald das
nämliche zu sagen scheinen, und im Grunde etwas
anderes bedeuten oder bedeuten
können: …”
| | |
| | | ? o ∕∕ | | |
Bedenke die
merkwürdige Projektionsweise durch die die
Zeichnung  in ein
menschliches Gesicht projiziert wird. in ein
menschliches Gesicht projiziert wird.
| | |
| | | / | | | Wer liest, macht das
was er
abhängig von dem was da steht. Aber
Abhängigkeit kann nur durch
eine Regel ausgedrückt werden.
| | |
| | | / | | | Was hätte übrigens
allgemeine Regel überhaupt
auszudrücken, wenn ?
| | |
| | | / | | |
Soweit er was er tut nicht von dem
abhängig macht was da steht, ˇsoweit liest er
nicht; wenn auch das was da steht ihn ˇzu dem
veranlaßt veranlassen mag zu tun was er
tut.
| | |
| | | / | | |
Der Vorsatz muß so sein daß sein Ausdruck es möglich
macht zu überprüfen, ob er ausgeführt
wurde. [ … ob die Absicht erreicht
wurde. ]
Es muß sich also die
richtige Ausführung aus der Vorlage und dem Ausdruck des
Vorsatzes ableiten ˇ(quasi berechnen)
lassen.
| | |
| | | / | | |
Wenn ich etwas beschreibe, so muß ich die Beschreibung
von dem Zubeschreibendem
herunterlesen. [ Wenn ich etwas beschreibe
& die Beschreibung von dem Zubeschreibendem nicht herunterlese so ist es keine
Beschreibung. ]
| | |
| | | ∫ | | |
Wenn ich die Beschreibung nicht von der
Tatsache ablese, so ist sie ˇeine ihr willkürlich
zugeordnete Lautverbindung [ so ist sie ein ihr
willkürlich zugeordneters Komplex
Gebilde
| | |
| | | ? / | | |
Wenn man sagt die
Sinnesdaten seien „privat”, niemand
anderer könne meine Sinnesdaten sehen, hören,
fühlen, & meint damit nicht eine Tatsache
Erfahrung Erfahrungstatsache, so müßte
ein philosophischer Satz sein.
Den gibt es aber nicht & was gemeint ist drückt sich
darin aus, daß eine Person in die Beschreibung von Sinnesdaten
nicht eintritt.
| | |
| | | / | | |
Denn, kann ein anderer meine
Zahnschmerzen nicht haben so kann ich sie – in diesem
Sinne auch nicht haben.
| | |
| | | / | | |
In dem Sinne in welchem es nicht erlaubt
ist zu sagen der Andere habe diese Schmerzen, in
die ist es auch nicht erlaubt zu sagen ich
sie.
| | |
| | | / | | | ⌊⌊Was soll es
heißen: Er hat diese Schmerzen?
außer er hat solche Schmerzen:
d.h. von solcher Stärke, Art
etc. aber ˇnur in dem⌋⌋ ⌊⌊Sinne kann
auch ich diese Schmerzen haben.⌋⌋
| | |
| | | | | | Was wesentlich privat ist, oder scheint, hat keinen
Besitzer. Das heißt die
Subject-Object-Form
ist darauf nicht anwendbar.
| | |
| | | / | | |
Die
Subject-Object-Form
bezieht sich auf
Leib & die Dinge um ihn, die auf ihn wirken.
| | |
| | | / | | |
13.
Es scheint ein Einwand gegen die
Beschreibung des unmittelbar [e|E]rfahrenen zu
sein: „für wen beschreibe
ich's?” Aber wie wenn ich es
abzeichne? Und die Beschreibung muß
immer ein nachzeichnen sein.
Und soweit
(überhaupt) eine Person
für das Verstehen in Betracht kommt steht, die meine & die
des anderen auf einer Stufe. Es ist doch hier ebenso wie
mit den Zahnschmerzen.
| | |
| | | / | | |
Beschreiben ist nachbilden & ich
muß es nicht notwendigerweise für irgend jemand
nachbilden.
| | |
| | | / | | |
Wenn ich mich mit der Sprache dem Andern
verständlich mache, so k muß es
sich hier um ein Verstehen im Sinne des
[B|b]ehaviourism handeln. Daß er mich
verstanden hat ist eine Hypothese, wie, das ich ihn verstanden
habe.
| | |
| | | / | | |
In die der nicht-hypothetischeˇn
Beschreibung des Gesehenen, Gehörten – diese
Wörter bezeichnen hier grammatische Formen – tritt das
Ich nicht auf es ist hier von Subject und
Object nicht die Rede.
| | |
| | | / | | |
„Für wen beschreibe
ich würde ich meine unmittelbare Erfahrung
beschreiben? Nicht für mich, denn ich habe
sie ja; & nicht für ein jemand andern, denn
der könnte sie nie aus der Beschreibung
entnehmen?” – Er kann sie so
& so wenig aus der
Beschreibung entnehmen wie aus einem gemalten Bild.
Und aus Die Vereinbarungen über die Sprache
sind doch mit Hilfe von gemalten Bildern (oder was diesen
gleichkommt) getroffen worden. Und⌊,⌋ –
unserer gewöhnlichen Ausdrucksweise nach⌊,⌋
– entnimmt er doch aus einem gemalten Bild etwas.
Und zu fragen, ob er dasselbe entnimmt was wir sehen ist ja Unsinn;
ebensolcher Unsinn wie die Frage ob mich mein Gedächtnis
nicht täuscht wenn es mir sagt daß das die Farbe ist die ich
schon ge vor einer Minute in diesem Bild gesehen
habe.
| | |
| | | / | | |
Es ist eben irreführend zu sagen „das Gedächtnis
sagt mir daß dies dieselbe Farbe ist”
etc.” Sofern es mir etwas sagt, kann es
mich auch täuschen (d.h. etwas
falsches sagen).
Wenn
ich die unmittelbar gegebene Vergangenheit beschreibe so beschreibe
ich mein Gedächtnis & nicht etwas was dieses
Gedächtnis anzeigt. (Wofür dieses
Gedächtnis ein Symptom wäre.)
| | |
| | | / | | | Und
„Gedächtnis” bezeichnet hier – wie
früher „Gesicht” & und
„Gehör” – auch nicht ein psychisches
Vermögen, sondern einen
bestimmten Teil der logischen Struktur unserer
Welt.
| | |
| | | ∫ | | | Wenn ich nicht recht weiß wie ein Buch
anfangen so kommt das daher das noch etwas unklar ist. Denn
ich möchte mit dem ge der Philosophie
gegebenen, den geschriebenen &
gesprochenen Sätzen, ˇquasi den Büchern
anfangen
Und hier begegnet man der
Schwierigkeit des „Alles
fließt”. Und mit ihr
ist vielleicht überhaupt anzufangen.
| | |
| | | ∫ | | | Handelt die
Mathematik von ?
Ebensowenig wie das Schachspiel von Holzfiguren handelt.
| | |
| | | / | | | Wenn wir
hier davon reden von dem Sinn mathematischer
Sätze reden oder wovon sie handeln so gebrauchen wir ein
falsches Bild. Es ist nämlich hier auch so als ob
ˇan sich unwesentliche willkürliche Zeichen
das Wesentliche, eben den Sinn, mit einander gemeinsam haben
gemein
hätten |
.
| | |
| | | / ∫ | | |
1[5|6].
Weil die Mathematik ein
Kalkül ist & daher wesentlich von nichts
handelt, gibt es keine Metamathematik.
| | |
| | | / | | | Man kann nur immer
Unwesentliches ausdrücken.
Wenn
ich
z.B. die Philosophie mit dem Satz beginnen
wollte daß wir hier eine
Sprache zur Darstellung der Tatsachen gebrauchen, so wäre dies
wieder unwesentlich, das Wesentliche aber daß eine solche Sprache
gebraucht werden kann, kann nicht gesagt
werden.
| | |
| | | / | | |
Irgendetwas sagt mir: eigentlich dürfte ein Widerspruch
in den Axiome[in|n] eines Systems nicht schaden, als bis
er offenbar wird. Man denkt sich einen
versteckten Wi[e|d]erspruch wie eine versteckte
Krankheit die schadet obwohl (und vielleicht gerade
deshalb weil) man sie sich uns nicht deutlich
zeigt. Zwei [s|S]pielregeln aber die
einander in einem für einen bestimmten
Falle
widersprechen sind vollkommen in der Ordnung bis dieser Fall eintritt
& dann erst wird es nötig durch eine weitere Regel
zwischen ihnen zu entscheiden.
| | |
| | | / | | |
17.
Auch die Logik ist keine
Metamathematik[;|,]
d.h. auch
Operationen des das Arbeiten mit dem logischen
Kalkülss können kann keine ˇwesentlichen
Wahrheiten über die Mathematik zu
[t|T]age fördern. Siehe hierzu das
„Entscheidungsproblem” und
ähnliches in der modernen
mathematischen Logik.
| | |
| | | / | | |
Kein Kalkül kann ein
[P|p]hilosophisches Problem entscheiden.
| | |
| | | ø | | | 25. Wer seiner Zeit nur voraus ist,
den holt sie einmal ein.
| | |
| | | / | | | 27. Der Kalkül kann uns nicht prinzipielle
Aufschlüsse über die Mathematik geben.
| | |
| | | / | | | Es kann
auch keine „führenden
Probleme” der mathematischen Logik geben, denn das
wären solche deren Lösung uns endlich berechtigen würde
das Recht geben
würde |
Arithmetik zu treiben wie
wir es tun.
| | |
| | | / | | | Und dazu können wir nicht auf den
Glucksfall der Lösung eines
mathematischen Problems warten. | | |
| | | ø | | |
12.[2|1].31
Die Musik scheint manchem eine
primitive Kunst zu sein mit ihren wenigen Tönen &
Rythmen. Aber einfach ist nur ihre
Oberfläche [ ihr Vordergrund ]
während der Körper der die Deutung dieses manifesten
Inhalts ermöglicht die ganze unendliche Komplexität besitzt
die wir in dem Äußeren der anderen Künste angedeutet
finden & die die Musik verschweigt. Sie ist in
gewissem Sinne die raffinierteste aller Künste.
| | |
| | | ø | | | 16.
Es gibt Probleme an die ich nie
herankomme, die nicht in meiner Linie oder in meiner Welt
liegen. Probleme der Abendländischen
Gedankenwelt an die Beethoven (& vielleicht teilweise
Goethe)
herangekommen ist & mit denen er gerungen hat die aber kein
Philosoph je angegangen hat (vielleicht ist
Nietzsche an ihnen
vorbeigekommen). Und vielleicht
sind sie für die abendlandische
Philosophie verloren
d.h. es wird niemand
da sein der den Fortgang dieser Kultur als Epos empfindet
beschreiben kann.
Oder richtiger sie ist eben kein Epos mehr oder doch nur für
den der sie von außen betrachtet & vielleicht hat dies
Beethoven
vorschauend getan (wie Spengler einmal andeutet) Man
könnte sagen die Zivilisation muß ihren Epiker
voraushaben. Wie man den eigenen Tod nur
voraussehen und vorausschauend beschreiben nicht als
Gleichzeitiger von ihm berichten kann. Man
könnte also sagen: Wenn [d|D]u das Epos
einer ganzen Kultur sehen
willst so mußt Du es unter den Werken der
Größten dieser Kultur also zu einer Zeit suchen in
der das Ende dieser Kultur nur hat vorausgesehen werden
können, denn später ist niemand mehr da um es zu
beschreiben. Und so ist es also kein Wunder wenn
es nur in der dunklen Sprache der
geschrieben ist
& für die Wenigsten verständlich.
| | |
| | | ø | | |
Ich aber komme zu diesen Problemen überhaupt
nicht. Wenn ich „have done with the
world” so habe ich eine amorphe
(durchsichtige) Masse geschaffen & die Welt mit ihrer ganzen
Komplexität Vielfältigkeit
bleibt wie eine uninteressante Gerümpelkammer links
liegen.
Oder vielleicht
richtiger, : das ganze Resultat der
ˇganzen Arbeit ist das Linksliegenlassen der
Welt. (Das
[i|I]n-die-Rumpelkammer-werfen der ganzen
Welt)
| | |
| | | o ∕∕ | | | Eine Tragik gibt es in
dieser Welt – in ⌊(⌋der meinen⌊)⌋
– nicht & damit all das Unendliche nicht was
eben die Tragik (als sein
) hervorbringt.
Es ist sozusagen alles in dem
Ether Weltether
löslich; es gibt keine Härten.
Das
heißt die Härte und der Konflikt wird zu nichts Herrlichem
nicht zu
etwas Herrlichem |
sondern zu einem
Fehler.
| | |
| | | ø | | | Der Konflikt löst sich
etwa wie die Spannung einer Feder in einem Mechanismus, den man
schmilzt (oder in Salpetersäure auflöst).
In Lösung
gibt es keine Spannungen mehr.
| | |
| | | o ∕∕ | | | Das meiste was
sich mir als Ahnungsvolle Gedankenform zeigt kann ich gar nicht
ausdrücken & meine Ausdruckskraft erlahmt vielleicht
immer mehr & mehr.
| | |
| | | / | | |
17.
Das Verständnis eines Satzes kann nur
die Bedingung dafür sein daß wir ihn anwenden können.
D.h. es kann nichts sein als diese Bedingung
& es muß die Bedingung der Anwendung sein.
| | |
| | | ? / ∫ | | | Wer
das Symbol versteht kann nicht mehr
als das Symbol, denn
mehr ist nicht da.
| | |
| | | / ∫ | | |
Alles was zum Verständnis des
Symbols nötig ist e⌊n⌋thält es & was es nicht
enthält ist für die Sache überhaupt belanglos.
Also muß die Kenntnis des Symbols nicht nur
ausreichend sein sondern keine Kenntnis außerdem auch nur
eine Hilfe, sondern – wie gesagt – ganz
belanglos.
| | |
| | | / | | |
Das Verständnis eines Befehls kann
nur die Bedingung dessen sein daß ich ihn ausführen
kann. Nicht mehr & nicht weniger.
| | |
| | | / | | | Wenn mir das
Verstehen des Befehles bei der Ausführung nicht hilft, dann
interessiert es mich überhaupt nicht.
| | |
| | | ∫ | | | Das Verstehen des Befehles
könnte etwa ein Spiel der Vorstellungen sein, es fragt sich aber
ist es zur Behandlung des Befehls wesentlich oder
nicht?
| | |
| | | ∫ | | |
Wenn z.B. der
Befehl gelautet hätte, ich solle aus
dem Zimmer gehen, so könnte man glauben der
befehl sei befolgt wenn ich, etwa zur
festgesetzten Stunde das Zimmer verließe. Aber das
hatte ja auch „rein
mechanisch” nicht dem Befehl folgend geschehen
können. Es wäre auch nicht genug daß etwa
der das Hören des Befehls d auf
irgend eine Weise die Ursache davon wäre daß ich das Zimmer
verl[ass|ies]en
habe. Der
Befehl wurde vielmehr nur dann befolgt wenn ich die Befolgung von ihm
abgelesen habe. Dazu ist etwa nötig daß ich auf die
Uhr sehe & auf die Zeit warte bis der Befehl auszuführen
ist (oder vielmehr gehört eben auch das schon zur
Ausführung oder doch zur Reaktion auf den
Befehl).
In Wirklichkeit wird es sich so
vollziehen daß ich auf die Uhr sehe dann an [das| etwas]
anderes denke dann wieder auf die Uhr sehe u.s.w. Was ist also
Wesentlich? Daß ich es einmal
merke ob ich die Zeit eingehalten habe oder nicht.
D.h. es muß mir einmal die
Übereinstimmung oder
Nicht-[ü|Ü]bereinstimmung meiner Handlung mit
dem Befehl zu Bewußtsein kommen. Wenn
(d.h. gerade wenn) das geschieht dann
verstehe ich den Befehl.
| | |
| | | | | |
Nocheinmal: Das
Verstandnis ist eine Bedingung des
Befolgens. Nun, was für eine Bedingung der
Befolgung gibt es denn?
Das Verstehen
soll ja das Erfassen des Befehls als solchen sein.
Das Erleben des Befehls als Befehl, ohne das ist er für mich
ˇja noch gar [K|k]ein Befehl. Und ist
er, ⌊es,⌋ dann habe ich ihn auch verstanden.
Das Verstehen des Befehls muß das Erfassen des Zeichens mit dem
sein was das Zeichen zum Zeichen eines Befehls
macht.
| | |
| | | / | | |
Einen Satz verstehen heißt eine Sprache verstehen.
| | |
| | | / | | | Von einem
Verständnis das ˇherbeizuführen wir wesentlich keine
Mittel haben, konnen wir nicht
reden.
| | |
| | | ∫ | | |
18.
Wenn wir d meinen
daß der Gedanke die Tatsache gleichsam in schattenhafter Weise
anticipiert so geschieht das eben deshalb
weil es der Gedanke ist. Das heißt weil sein
Ausdruck die Beschreibung seiner Verification
enthält.
| | |
| | | / | | |
Der Philosoph trachtet das erlösende
Wort zu finden; das ist das Wort das uns endlich erlaubt das zu fassen
was bis jetzt immer ungreifbar unser Bewußtsein belastet
hat.
| | |
| | | o ∕∕ ∫ | | |
(Es ist wie
wenn man ein Haar auf der Zunge liegen hat; man spürt es aber kann
es nicht erfassen ergreifen & darum nicht
loswerden.)
| | |
| | | ø | | |
Der Philosoph liefert
uns das Wort womit die Sache ausdrücken
& unschädlich machen kann.
| | |
| | | ø | | | Wenn ich sage
daß mein Buch nur für einen kleinen Kreis von Menschen
bestimmt ist (wenn man das einen Kreis nennen kann) so will ich
damit nicht sagen daß dieser Kreis ˇmeiner Auffassung nach
die Elite der Menschheit ist aber es sind die Menschen an die
aber es ist der Kreis an
den |
ich mich wende
(nicht weil sie besser oder schlechter sind als die andern
sondern) weil sie mein Kulturkreis sind gleichsam die
Menschen meines Vaterlandes im Gegensatz zu den anderen, die
mir fremd sind.
| | |
| | | / | | |
22.
Kein psychologischer Vorgang kann besser
symbolisieren als Zeichen die auf dem Papier stehen.
| | |
| | | / | | | Der psychologische
Vorgang kann auch nicht mehr leisten als die Schriftzeichen auf dem
Papier.
| | |
| | | ? / | | |
Denn immer wieder ist man in
der Versuchung einen S symbolischen
Vorgang durch einen besonderen psychischen Vorgang
erklären zu wollen, als ob die Psyche in dieser Sache viel mehr
tun könnte, als das Zeichen.
| | |
| | | / | | | Es mißleitet uns da die
falsche Analogie mit einem Mechanismus der mit anderen Mitteln
arbeitet & daher eine besondere Bewegung
erklären kann. Wie wenn wir sagen: diese
Bewegung kann nicht durch den Eingriff von Zahnrädern allein
erklärt werden.
| | |
| | | / | | |
Hierher gehört irgendwie:
daß es nicht selbstverständlich ist, daß sich das Zeichen
durch seine Erklärung ersetzen
läßt⌊.⌋,
[s|S]ondern eine merkwürdige, wichtige Einsicht in das
Wesen dieser (Art von)
Erklärung.
| | |
| | | / | | |
Die Beschreibung des Psychischen
müßte sich ja doch wieder als Symbol verwenden lassen.
| | |
| | | / | | | Wenn wir die
Disposition ein Zeichen „a a d d d c b a”
mittels der Regel „a
→
b ↑
c ←
d
↓” zu
übersetzen eben durch „a
→
b ↑
c ←
d
↓” ausdrücken
dann kann in jener Disposition auch nicht wesentlich mehr liegen als
in dem Zeichenausdruck für die Regel.
| | |
| | | / | | | Das heißt diese
Disposition unterscheidet sicht etwa von der den Satz
nach „a
←
b ↗
c ↙
d
→” zu
übersetzen wie das Zei erste Regelzeichen
vom zweiten.
| | |
| | | ∫ | | |
Wenn ich den Satz a a d d d b c
nach a →
b ←
c ↑
d
↓ in
übertrage,
so richte ich mich nach der Regel im selben Sinn wie wenn ich
1 2 3 4 nach in x … x² in 1 4 9
16 übertrage.
| | |
| | | / | | | Im
speziellen Fall kommt natürlich die Regel nicht mit Betonung
ihrer [a|A]llgemeinheit vor wie in
f(a) nicht
f(x) als etwas Allgemeines
vorkommt.
| | |
| | | ? / | | |
Wenn ich nun wie oben
übertrage so liegt die Über Art der
Übertragung an in der Art wie ich zu dem
Resultat der Übertragung gekommen bin. Es ist ja
unleugbar daß ich auf verschiedene Weise von 1, 2, 3, 4 zu 1, 4, 9,
16 kommen kann & mehr kann ich nicht behaupten.
Wenn ich nun einen Sachverhalt in Worten
beschreibe, etwa die Gestalt & Farbe eines Flecks, so schaue
ich allerdings dazu auf keine Übertragungsregel
Rechnungsregel |
wohl aber erhalte ich doch die Worte
der Beschreibung in einer ganz bestimmten Weise, verschieden von der,
einfach irgend welche Laute auszustoßen oder auch mich auf
assotiativem Wege zu solchen Lauten führen
zu lassen. Beschreibe ich z.B. einen
Fleck mit gewissen Worten so ist es ja denkbar daß ich dazu Worte
gebrauche die ich noch nie gehört & nie gebraucht
habe. Es wäre wenigstens der Fall denkbar daß meine
Umgebung (die etwa ständig bei mir
s[ei|st])
diese Worte nie gehört
hat & mich (also) auch nicht
versteht daß ich mir aber (wie sich die Leute ausdrücken
würden) einbilde, die Dinge hießen so.
Dann habe ich eben damit eine Sprache erfunden. Denn wie
ich es verstehe heißen die Dinge so wenn ich mir einbilde daß
sie so heißen
| | |
| | | / | | |
Einen Satz verstehen heißt eine Sprache
verstehen & einen Satz sprechen heißt eine Sprache
sprechen.
| | |
| | | ∫ | | |
23.
„Verstehst Du das Wort
‚Tisch’?” –
„Ja” – „Was heißt
es?” – ˇ(mit einer Gebärde)
„So eine Sache” –
„Verstehst Du das Zeichen ‚So eine
Sache’?”
„Ja” – „was bedeutet
[sie|es]?” –
| | |
| | | ∫ | | | Die
Projectionsmethode ist die Art & und
Weise wie wi[e|r] 1, 4, 9 von 1, 2, 3
ableiten. oder
von a a b b c
| | |
| | | ∫ | | |
Es ist eben ein Unterschied, ob ich von dem
einen Zeichen irgendwie beeinflußt das andere
hinschreibe, oder es von dem
ablese.
| | |
| | | ∫ | | | Und die
[C|K]ausale
[b|B]eeinflußung ist ja kein
bewußter Vorgang.
| | |
| | | | | | Wenn
ich mich aber nun ärgere weil jemand zur Türe
hereinkommt, kann ich mich hier im Nexus irren oder ist er
wie erlebe ich ihn wie den
Ärger
In einem gewissen Sinne
kann ich mich ärgern irren denn ich kann
mi[c|r]h
f[r|s]agen „ich weiß nicht, warum mich sein Kommen heute so
ärgert”. Das heißt über die Ursachen
meines Argers läßt sich
streiten. – Anderseits nicht darüber daß der
Gedanke an sein kommen – wie man sagt
– unlustbetont ist.
| | |
| | | | | |
Wie aber in dem Fall: Ich sehe den Menschen &
der Haß gegen ihn lodert bei seinem Anblick ˇin mir gegen
ihn auf – Könnte man fragen: wie
weiß ich daß ich ihn hasse, daß er
die Ursache meines Hasses ist. Und wie weiß
ich daß sein Anblick diesen Haß neu erweckt? Auf
die erste Frage: „ich hasse ihn” heißt
nicht „ „ich hasse & er ist die
Ursache meines Hasses”. Sondern er
beziehungsweise sein Gesichtsbild – etc – kommt in meinem Haß vor ist
ein Bestandteil meines Hasses. (Auch hier
tut's die Vertretung nicht, denn was
guarantiert mir dafür daß das
Vertretene existiert.) Im zweiten Falle
kommt eben unmittelbar
Erscheinung in meinem Haß vor oder, wenn nicht, dann ist
seine Erscheinung wirklich nur die hypothetische Ursache meines
Gefühls & ich kann mich darin irren daß sie es ist die
das Gefühl hervorruft.
| | |
| | | | | |
Ganz ebenso muß es sich auch mit dem Handeln nach
einem Zeichenausdruck verhalten. Der
Zeichenausdruck muß in diesem Vorgang involviert
sein während er nicht involviert ist, wenn er
ˇbloß die Ur-sache meines Handelns
ist.
| | |
| | | ∫ | | |
[Ich weiß daß, was ich hier seit vielen Wochen schreibe
schlecht ist; aber ich schreibe es in der Hoffnung daß besseres
wieder nachkommen möge. Kommt nichts besseres nach,
nun so hat es eben der Schluß sein sollen.]
| | |
| | | | | | Und so ist es auch: aus ihm leite
ich mein Handeln ab.
| | |
| | | / | | |
Wenn ich nun sage ich leite mein
Handeln aus dem Zeichenausdruck auf eine gewisse Weise
ab so kann diese Weise im tatsächlichen Vorgang nur so enthalten
sein wie eben eine Funktion f(x) in
f(a)
| | |
| | | / | | | Wenn der
Satz „ich ha[ß|sse] A ihn” so aufgefaßt wird: Ich hasse
& er ist die Ursache; dann ist die frage
möglich: „bist Du sicher daß Du
ihn haßt ist es nicht vielleicht ein anderer oder etwas
Anderes” und das ist offenbar Unsinn.
| | |
| | | / | | |
Übrigens ist der einzige Beweis daß
eine Analyse falsch ist, daß sie zu offenbarem Unsinn
führt d.h. zu einem Ausdruck der
offenbar gegen die Grammatik st
verstößt die der ˇArt der Anwendung
entspricht.
| | |
| | | / | | |
Wenn ich an ihn denke: welche
Bedingungen müssen erfüllt sein daß das
wirk der Fall ist? Welche
nicht-hypothetischen Bestimmungen? Wenn ich ihn
– z.B. – erwarte: muß er jetzt
existieren, muß ich ein Erinnerungsbild an
ihn von ihm haben? Muß ich ihn
einmal gesehen haben? Und in welchem Sinne.
Was immer nicht der Fall gewesen sein muß, schalten wir
aus & was der Fall sein muß macht die Existenz des
Gedankens aus.
| | |
| | | / | | |
24.
Wenn ich eine Lautreihe hervorbringe
& nun sage ich habe diesen Satz gelesen so kann kein
Zweifel darüber bestehen ob ich wirklich diesen Satz
gelesen habe oder ob meine Lautreihe anders anderswie verursacht wurde.
D.h.
daß ich
d[en|ies]⌊en⌋
Satz gelesen habe sagt gar nichts über die Ursache der Entstehung
der Lautreihe aus.
| | |
| | | / | | |
Es kann nie essentiell für uns sein
daß ein Phänomen in der Seele sich abspielt &
nicht auf dem Papier für den Andern sichtbar.
| | |
| | | / | | | Man kann sagen
daß, ob ich lese oder nur Laute hervorbringe während ein
Text vor meinen Augen ist sich nicht durch die Beobachtung von
außen entscheiden läßt. Aber das Lesen kann
nicht wesentlich eine innere
Angelegenheit sein. Das Ableiten der Übersetzung
vom Zeichen, wenn es überhaupt ein
Vorgang ist, muß auch ein sichtbarer Vorgang sein
können. Man muß also z.B.
auch den Vorgang dafür
können der sich auf dem Papier abspielt wenn die
Glieder der Reihe 1, 4, 9, 16 (als Übersetzung von 1, 2,
3, 4) durch die Gleichungen
1 × 1 =
1,
[1|2] × 2
= 4,
3 × 3 =
9 etc ausgerechnet
erscheinen.
1
×
1
“
1
| 2
×
2
“
4
| 3
×
3
“
9
| 4
×
4
“
16
|
Man könnte dann vom Standpunkt des
Behaviourism
sagen, : Wenn ein Mensch das
hinschreibt dann hat er die untere Reihe durch Rechnung gewonnen,
schreibt er aber bloß die untere Reihe an dann nicht.
Schriebe er aber nun die Reihe
1
×
1
“
1
| 2
×
2
“
5
| 3
×
3
“
9
| 4
×
4
“
20
|
so würden wir sagen, er hat falsch
gerechnet weil
2 × 2 nicht
5 ist etc.
| | |
| | | / | | |
Man könnte natürlich
ebensogut schreiben
diese Darstellung ist
ganz gleichwertig mit der ersten oder überhaupt jeder
andern, wenn eine Regel festgesetzt ist die sie von einer anderen
Darstellung unterscheidet.
| | |
| | | / | | |
Das Gefühl welches man bei jeder
solchen Darstellung hat, daß sie roh (unbe-holfen) ist, leitet irre
denn wir sind dann versucht nach einer
„besseren” Darstellung zu suchen. Die
gibt es aber gar nicht. Eine ist so gut wie die andere
solange die Multiplizität die richtige ist; d.h. solange jedem Unterschied im Dargestellten
ein Unterschied in der Darstellung entspricht.
| | |
| | | / | | | Und nun kann aber
auch der Gedanke als psychischer Prozess
nicht mehr tun als dieses „rohe” Zeichen.
| | |
| | | / | | | Man kann
nicht fragen: W[as|elcher] für
eine
Art sind die geistigen Vorgänge daß sie wahr & falsch
sein können was die anderen außergeistigen nicht
können. Denn wenn es die
⌊„⌋geisti⌊gen”⌋gen
können so müssen es auch die anderen können; und
umgekehrt.2
| | |
| | | | | |
Denn
können es die
Vorgänge so muß es auch die Beschreibung können.
Denn in ihrer Beschreibung muß es sich zeigen wie es
möglich ist.
| | |
| | | / | | |
25.
Wenn man sagt der
Gedanke sei eine S seelische Tätigkeit
so denkt man an oder eine Tätigkeit des Geistes
so denkt man den Geist als ein trübes gasförmiges Wesen in
dem manches geschehen kann das außerhalb nicht geschehen
kann. Und von dem man manches erwarten
(kann
das sonst nicht möglich ist.
Es
gleichsam die Lehre von
Gedanken vom organischen Teil im Gegensatz zum anorganischen des
Zeichens.
| | |
| | | / | | |
Es ist gleichsam der Gedanke der organische Teil des
Ge Symbols das Zeichen der anorganische.
Und dieser jener organische Teil
kann Dinge leisten die der anorganische nicht
könnte.
| | |
| | | | | | Als
geschähe hinter dem Ausdruck noch etwas
[w|W]esentliches was sich nicht durch den Ausdruck ersetzen
ausdrücken |
läßt – auf das sich
etwa nur hinweisen läßt – was in dieser Wolke (dem
Geist) geschieht & den Gedanken erst zum Gedanken
macht. Wir denken hier an einen Vorgang
das
S Denken |
analog
dem Vorgang der Verdauung & die Idee ist daß im
inneren des Körpers andere c[k|h]emische
Veränderungen vor sich gehen als wir sie außen
produzieren können, daß der organische Teil der
Verdauung einen anderen Chemismus hat als was wir außen
mit den Nahrungsmitteln vornehmen könnten.
| | |
| | | | | | Oder: Als
bestunde gleichsam der Gedanke aus
einem anorganischen Teil (dem Zeichen) und einem
organischen⌊,⌋ (etwa der
Interpretation)⌊,⌋ die wesentlich geistig wäre.
| | |
| | | ∫ / | | |
26
Man kann natürlich
nicht sagen: Der Satz ist, was wahr oder falsch
ist. ([a|A]ls würde dadurch noch
etwas ausgeschlossen.)
| | |
| | | / | | |
Die Intention soweit sie uns etwas angeht
kann nichts wesentlich psychisches sein.
| | |
| | | / | | | Da uns eine
Maschinerie des Geistes nichts angeht so
wir uns auch
einen Maschinenmensch konstruieren können der alles leisten könnte
muß
leisten können |
, was
für uns wesentlich ist.
| | |
| | | ∫ | | |
Immer wieder möchte man nach dem
Zweck des Denkens fragen: Wozu denkt
man überhaupt, wozu diese Tätigkeit. Aber was
für eine Antwort will man darauf erhalten?
Wir fühlen daß das Denken nur als Instrument
Wert haben kann
| | |
| | | ∫ | | |
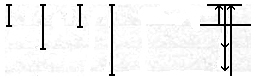 Ein Schema der
Überlegung. Wir ziehen was uns gegeben ist in
betracht & kommen zu einem
Resultat. Ein Schema der
Überlegung. Wir ziehen was uns gegeben ist in
betracht & kommen zu einem
Resultat.
| | |
| | | ∫ | | |
27.
Von einem Bild zu sagen es ist das Bild
dieses Vorgangs ändert das Bild.
| | |
| | | ∫ | | | Das Bild muß endlich
ˇganz﹖ für sich selbst sprechen.
| | |
| | | / | | | Ein Zeichen
ist doch immer für ein lebendes Wesen da also muß das etwas dem Zeichen
wesentliches sein. Gewiss:
auch ein Sessel ist immer nur für einen Menschen da aber er
läßt sich beschreiben ohne auf daß wir
auf seinen von seinem Zweck reden.
Das Zeichen hat nur einen Zweck in der menschlichen Gesellschaft
aber dieser Zweck kümmert uns gar nicht.
Ja am Schluß sagen wir überhaupt keine Eigenschaft von den
Zeichen aus – denn diese interessieren uns nicht – sondern
nur die (allgemeinen) Regeln ihres
gebrauchs. Wer das Schachspiel
beschreibt, gibt weder Eigenschaften der Schachfiguren an noch redet
er vom Nutzen & Gebrauch des Schachspiels.
| | |
| | | | | | Wäre der Gedanke sozusagen eine
Privatbelustigung & hätte nichts mit der
Außenwelt zu tun so wäre er für uns ohne
jedes Interesse (wie etwa die Gefühle bei einer
Magenverstimmung) Was wir wissen wollen
ist: Was hat der Gedanke mit dem zu tun was außer dem
Gedanken vorfällt. Denn seine Bedeutung ich meine
seine Wichtigkeit bezieht er ja nur daher.
Was hat das was ich denke mit dem zu tun was der Fall
ist.
| | |
| | | | | | Wenn ich A kenne
& weiß das B sein Sohn ist so weiß ich damit nicht
wie B ausschaut. So hilft mir keine äußere
Relation [ Beziehung der
Representation ] die Sache zu
kennen, wenn mir ihr Vertreter gegeben
ist.
| | |
| | | ∫ | | |
Der Gedanke ist von dem
was ihn wahr macht verschieden, & verschiedener, als
eben nicht Dasselbe, kann er nicht
sein.
| | |
| | | ∫ | | |
28.
Er hängt nur mit einem anderen Vorgang zusammen, wenn er angewendet
wird, d.i., wenn er übertragen
wird.
| | |
| | | ∫ | | |
Kann man sagen, die Worte des Satzes (oder die Bestandteile des
Gedankens) vertreten nur während des Übertragens
der Übertragung |
?
| | |
| | | / | | |
⌊⌊Aufz.⌋⌋ Das was den
Gedanken wahr macht, kann nicht vorausbestimmt sein, weil es
eben sonst wäre.
„Aber es ist vorausbestimmt, wie es , wenn der Gedanke wahr
ist.” Aber mehr brauchte es doch nicht, eben die
Tatsache, die Verification, zu geben.
Dieses „der Satz , was der Fall
ist, wenn er wahr ist”, sagt eben nichts, denn p zeigt
eben daß p der Fall ist, wenn etc. D.h. auf
die Frage „was denn der Fall
wenn …?” könnte nur p zur Antwort
kommen. Das ist aber eine bloße Tautologie.
| | |
| | | ∫ | | | Die
Schwierigkeit liegt im Begriff des Bestimmens.
| | |
| | | | | | Was der Satz eigentlich bestimmen,
müßte, wäre quasi, daß p oder
~p der Fall ist sein muß, aber das
ist nur scheinbar eine
Bestimmung, in Wirklichkeit bestimmt es aber gar nichts.
⇒ Fortsetzung im
V. Band3 | | |
| | | | | |
ist, dann liegt die Antwort in der Beschreibung
des
Das was sie macht
desjenigen was sie macht |
.
| | |
| | | ∫ | | | Es ist ungemein schwer die
Idee gänzlich los zu werden, daß die
Erklärung [v|V]erborgenes beleuchten
soll.
| | |
| | | / | | |
Der Solipsismus könnte durch die Tatsache widerlegt werden,
daß das Wort „ich” in der Grammatik keine
zentrale Stellung hat, sondern ein Wort ist wie jedes andre
Wort.
| | |
| | | / | | |
Gäbe es in der Welt wesentlich Subjekt & Objekt dann
müßte das Wort ‚ich’ in einer einzigartigen
Weise den anderen Worten entgegengestellt sein.
| | |
| | | / | | | Wie im
Gesichtsraum so gibt es in der Sprache kein metaphysisches
Subjekt.
| | |
| | | / | | |
Die Worte „sicher sein
daß” kann man nur in von einer
Hypothese gebrauchen. Es heißt nichts zu sagen
„ich bin sicher daß ich Zahnschmerzen habe”
außer in einem System in dem es doch möglich ist zu zweifeln ob
ich es Zahnschmerzen habe sind
Kann ich denn aber
nicht sagen: Ich bin sicher daß ich bald ein Licht
sehen werde?
(Oder: „daß ich bald Zahnschmerzen kriegen
werde”) Und doch war etwas Wahres an der
obigen Bemerkung.
| | |
| | | | | | Was
heißt es, sicher zu sein, daß man Zahnschmerzen haben
wird. (Kann man nicht sicher sein,
d[aß|ann] erlaubt es die Grammatik nicht das Wort in
dieser Verbindung zu gebrauchen.
| | |
| | | / | | |
4.2.
Man kann von einem Satz (im engeren
Sinne) nicht sagen daß die Wahrheit eines anderen ihn
bestätigt – ohne ihn zu beweisen.–
| | |
| | | ? / ∫ | | |
Man sagt: „Wenn ich sage daß ich einen
Sessel dort sehe so sage ich mehr als dessen ich sicher
weiß”. Und nun heißt es meistens:
„Aber eines wei[s|ß] ich doch
sicher”. Wenn man aber nun sagen will was das ist,
so kommt man in eine gewisse Verlegenheit.
| | |
| | | ? / | | | „Ich sehe
etwas Braunes, – das ist sicher”; damit will
man eigentlich sagen, daß die braune Farbe gesehen
& nicht vielleicht auch
vermutet ist (wie etwa in dem Fall wo ich aus gewissen anderen Anze⌊i⌋chen
) [ … & nicht vielleicht auch bloß aus
anderen Anzeichen vermutet ist. ] Und man sagt ja
auch einfach: „Etwas Braunes
sehe ich.”
| | |
| | | / | | |
Wenn mir gesagt wird:
„Sieh in dieses Fernrohr & zeichne mir auf, was
Du siehst”, so ist, was ich zeichne, der Ausdruck
eines Satzes, nicht einer Hypothese.
| | |
| | | ø | | |
(Es ist schwer in der
Philosophie nichts hinzuzudichten & nur die
Wahrheit zu sagen.)
| | |
| | | | | | Ist
es nicht klar daß es nur am Mangel von entsprechendem
Übereinkommen liegt, wenn ich daß was ich – z.B. – zeichnerisch
darstell[en|e] kann nicht wiedergeben kann?
| | |
| | | | | | Wenn ich sage „hier steht ein
Kessel” so meine ich da ist damit
– wie man sagt – „mehr” gemeint als die
Beschreibung dessen was ich wahrnehme. Und das kann
nur heißen daß dieser Satz nicht wahr sein muß auch
wenn die Beschreibung des Gesehenen stimmt. Unter welchen
Umständen werde ich nun sagen daß jener Satz nicht wahr
war? Offenbar: wenn gewisse andere Sätze nicht
wahr sind die in dem ersten mit beinhaltet waren.
Aber es ist nicht so als ob nun der erste ein logisches Produkt
gewesen wäre.
| | |
| | | | | | Wenn man
fragt „Wie macht der das, daß er
darstellt[”|?]” So
könnte die Antwort sein:
„[w|W]eißt [d|D]u es denn
(wirklich) nicht? Du siehst es
doch wenn du .” Es ist ja nichts
verborgen.
| | |
| | | | | | Wie macht
der Satz das? – Weißt Du es
nicht denn nicht? Es ist ja nichts
versteckt.
| | |
| | | | | |
Daß alles
fließt scheint uns am Ausdruck der Wahrheit zu
hindern, denn es ist als ob wir sie nicht auffassen
könnten da sie uns entgleitet.
| | |
| | | | | | Aber es hindert uns eben nicht am Ausdruck. – Was es heißt, etwas
entfliehendes in der Beschreibung
festhalten zu wollen, wissen wir. Das geschieht
etwa, wenn wir das eine vergessen, während wir das andere
beschreiben wollen. Aber darum handelt es sich doch hier
nicht. Und so ist
„entfliehen” anzuwenden.
| | |
| | | | | | Wir führen die Worte von ihrer
metaphysischen wieder auf ihre richtige Verwendung in der
Sprache zurück.
| | |
| | | | | |
Der Mann, der sagte, man könne nicht zweimal in den gleichen
Fluß steigen, sagte etwas falsches; man kann
zweimal in den gleichen Fluß steigen.
| | |
| | | | | | Und so sieht die Lösung aller
philosophischen Schwierigkeiten aus. Ihre
antworten müssen wenn sie richtig sind
hausbacken & gewöhnlich sein.
Aber man muß sie nur im richtigen Geist anschauen dann
macht das nichts.
| | |
| | | | | | Aber
auf die Antwort „Du weißt ja, wie es der Satz macht, es
ist ja nichts verborgen” möchte man sagen:
„ja, aber es fließt alles so rasch vorüber &
ich möchte es gleichsam breiter auseinandergelegt
sehen”.
| | |
| | | | | |
Aber auch hier irren wir uns. Denn es geschieht
dabei auch nichts was uns durch die Geschwindigkeit
entgeht.
| | |
| | | | | |
5.
Warum können wir uns keine Maschine mit einem Gedächtnis
denken? Es wurde oft gesagt daß das Gedächtnis
darin besteht daß Ereignisse Spuren hinterlassen in denen nun
gewisse Vorgänge vor sich gehen müßten.
Wie wenn also Wasser sich ein Bett macht & das folgende
Wasser in diesem Bett fließen muß; der eine Vorgang
fährt das Gleise aus, das den anderen
führt
fährt für den nächsten das Gleise aus |
. Geschieht dies nun aber in einer
Maschine, wie es wirklich geschieht, so sagt niemand, die Maschine
habe Gedächtnis oder habe sich den Vorgang gemerkt.
| | |
| | | | | | Nun ist das aber ganz so wie wenn
man sagt, eine Maschine kann nicht denken, oder kann keine Schmerzen
haben. Und hier kommt es drauf an was man darunter
versteht „Schmerzen zu haben”. Es
ist klar daß ich mir eine Maschine denken kann die sich genau
so benimmt (in allen Details) wie ein Mensch der Schmerzen
hat. Oder vielmehr: ich kann den
[a|A]ndern eine Maschine nennen die Schmerzen
hat[;| ,] D.h: den
andern Körper. Und ebenso
natürlich meinen Körper. Dagegen hat das
Phänomen der Schmerzen wie es auftritt, wenn
‚ich [s|S]chmerzen habe’ mit meinem
Körper d.h. mit den Erfahrungen die ich
darin ˇals Existenz meines Körpers
zusammenfasse gar nichts zu tun. (Ich
kann Zahnschmerzen haben ohne Zähne.) Und hier hat
nun die Maschine gar keinen Platz. – Es ist klar, die
Maschine kann nur einen physikalischen Körper ersetzen.
Und in dem Sinne wie man von einem solchen
sagen kann er „habe” Schmerzen kann man es auch von
einer Maschine sagen. Oder, wieder, die
Körper die wir von denen wir sagen sie
hätten Schmerzen, können wir mit Maschinen
vergleichen & auch Maschinen nennen.
| | |
| | | | | | Und ganz ebenso verhält es sich mit
dem Denken & dem Gedächtnis.
| | |
| | | | | | Es ist uns – wie gesagt – als
ginge es uns mit dem Gedanken so, wie mit einer Landschaft die wir
gesehen haben & beschreiben sollen aber wir
erinnern uns ˇihrer nicht genau genug um sie in
allen ihren Zusammenhängen beschreiben zu
können.
So, glauben wir, können wir
das Denken nachträglich nicht beschreiben weil uns alle
die vielen matteren
feineren
schwächeren |
Vorgänge dann verloren gegangen sind.
| | |
| | | | | | Diese feineren Verhäkelungen möchten wir
sozusagen unter der Luppe sehen
| | |
| | | ø | | |
(Einen unausgebrütetenc Gedanken muß man
zart behandeln um ihn am Leben zu erhalten.) Man
darf von ihm noch nichts verlangen & muß ihn im weichen
Medium der for⌊t⌋währenden Unsicherheit
betten.) Ist er flügge dann verläßt
er dieses Nest von selbst.)
| | |
| | | ∫ | | |
Alles wesentliche über den
Gedanken ist damit gesagt, daß der Gedanke daß p der
Fall ist nicht die Tatsache ist daß p der Fall ist.
Daß der Gedanke eine andere Tatsache
ist.
Ferner, daß der Gedanke, das
vollständige Symbol, Teil eines
ˇsymbolischen Systems von
Symbolen, einer Sprache, ist.
| | |
| | | ∫ | | | Wie verhält es sich
damit, daß der Gedanke nicht mißverstanden
– (oder verstanden) werden kann?
| | |
| | | ∫ | | |
Wie
Frege in
Cantors angebliche
Definition von „größer”,
„kleiner”, plus
„ + ”, „ ‒ ” etc statt dieser Zeichen neue Wörter
einsetzte um zu zeigen daß es keine wirkliche
Definition vorliege, ebenso könnte man in der ganzen Mathematik
statt der geläufigen Wörter insbesondere statt
de[r|s] W[ö|o]rte[r|s] ein
„unendlich” & verwandter
Ausdrücke & seiner Verwandten ganz neue bisher bedeutungslose
Ausdrücke setzen um zu sehen was der Kalkül mit diesen
Zeichen wirklich leistet & was er nicht leistet.
Wenn die Meinung verbreitet wäre, daß das Schachspiel
uns einen Aufschluß über Könige Kon
Könige & Türme gebe so würde ich
vorschlagen den Figuren and neue Formen
& andere Namen zu geben um zu demonstrieren
die Einsicht zu
erleichtern |
, daß alles zum
Schachspiel [g|G]ehörige in
Regeln liegen muß.
| | |
| | | / | | | Dem der
sagt „aber es steht doch wirklich ein Tisch hier”
muß man antworten: „freilich steht ein wirklicher
Tisch hier, – im
Gegensatz zu einem nachgemachten”.
Wenn er aber nun weiterginge &
sagte[;| ,] die Vorstellungen seien nur Bilder der
Dinge, so müßte ich (ihm)
wi[e|d]ersprechen & sagen daß der
Vergleich der Vorstellung mit einem Bilde des Körpers
ganzlich
irrefuhrend sei da es für ein Bild
wesen⌊t⌋lich sei daß es mit dem seinem
Gegenstand verglichen werden kann.
| | |
| | | / | | | Wenn aber
[E|e]iner sagt: „die Vorstellungen
sind das einzig [w|W]irkliche”, so muß
ich sagen daß ich hier das
„wirklich” nicht verstehe & nicht weiß
was für eine Eigenschaft man damit eigentlich den
Vorstellungen zuspricht & – etwa – den Körpern
abspricht. Ich kann ja nicht begreifen wie man mit Sinn
– ob wahr oder falsch – eine Eigenschaft Vorstellungen
& physikalischen Körpern zuschreiben kann.
| | |
| | | / | | |
Wenn
man sagt daß alles fließt so fühlen wir
daß wir gehindert sind das Eigentliche, die eigentliche
Realität festzuhalten. Der Vorgang auf der Leinwand
entschlüpft uns eben weil er ein Vorgang ist. Aber wir
beschreiben doch etwas; – & ist das ein anderer
Vorgang? Die Beschreibung steht doch offenbar gerade mit
dem Bild auf der Leinwand in Zusammenhang. Es muß
dem Gefühl unserer Ohnmacht ein falsches Bild zugrunde
liegen,. [d|D]enn was wir beschreiben
könn wollen können das können wir
beschreiben.
| | |
| | | / | | |
Ist nicht dieses falsche Bild das eines
Bilderstreifens der so geschwind vorbeiläuft daß wir keine
Zeit haben ein Bild aufzufassen.
| | |
| | | / | | | Wir würden
nämlich in diesem Fall geneigt sein dem Bilde
nachzulaufen. Aber dazu gibt es ja im Ablauf eines
Vorgangs nichts analoges.
| | |
| | | ? / | | |
Wenn das Wort daß man nicht
zweimal in den gleichen Fluß steigen kann
(nur)
daß inzwischen ein Wasser an die
[s|S]telle des alten
ist, so kann man aber zweimal den
gleichen grünen Fleck sehen & es ist hier
nichts was dem Verfließen des Wassers analog wäre.
| | |
| | | ∫ / / | | |
Das Gleichnis vom
der Zeit ist
natürlich irreführend & muß uns, wenn wir daran
festhalten in Verlegenheiten
.
| | |
| | | / | | |
Daß Die Wendung
„daß etwas „ in
unserem Geist” vor sich geht soll[–| ,]
glaube ich[–| ,] andeuten, daß es im physikalischen
Raum nicht lokalisierbar ist. Von unseren
Magenschmerzen sagt man nicht daß sie in unserem Geist vor sich
gehn obwohl der physikalische Magen z ja
nicht der ˇunmittelbare Ort der Schmerzen (in
einem primären Sinn) ist.
| | |
| | | ∫ | | | Wenn man frägt
wo das Denken vorsichgeht so muß man
vielleicht antworten: im
Gesichtsraum, im Raum gewisser
kinesthetischer
Empfindungen.
| | |
| | | ∫ | | |
Das ist aber falsch denn die Angabe des
Raumes ist keine Ortsangabe. (Die Angabe des Raumes ist
im letzten Grunde die Angabe einer Geometrie)
| | |
| | | ? / | | |
„Das Denken geht im Kopf vor sich” heißt
eigentlich nichts anderes, als, unser Kopf hat etwas mit dem
Denken zu tun. Man sagt freilich auch:
„ich denke mit der Feder auf dem Papier”
& diese Ortsangabe ist mindestens so gut wie die
erste.
| | |
| | | / | | |
Wenn wir fragen „Wo geht das Denken vor
sich” so ist dahinter immer die Vorstellung eines
maschinellen Prozesses der in einem geschlossenen Raum
vorsichgeht sehr
ähnlichc wie der Vorgang in der Rechenmaschine.
| | |
| | | / | | | Wenn
„einen Satz verstehen” heißt: in gewissem
Sinn nach ihm handeln, dann kann das Verstehen nicht die Bedingung
dafür sein, daß wir nach ihm handeln.
| | |
| | | / | | | Das Verstehen einer
Beschreibung kann man, glaube ich, mit dem Zeichnen eines Bildes nach
dieser Beschreibung vergleichen. (Und hier ist wieder
das Gleichn⌊i⌋s ein besonderer Fall dessen wo es
wofür es ein Gleichnis ist) Und es
auch in vielen
Fallen als der Beweis des
Verständnisses aufgefaßt.
| | |
| | | / | | |
Was heißt es, ein gemaltes Bild zu
verstehen?
Auch da gibt es Verständnis
und Nichtverstehen.
| | |
| | | / | | |
Und auch hier kann verstehen &
nicht verstehen verschiedenerlei heißen. – Wir
können uns ein Bild denken das eine Anordnung von
Gegenständen im 3-dimensionalen Raum
dastellen soll, aber wir sind für einen Teil des
Bildes unfähig Körper im Raum darin zu sehen sondern sehen
nur die gemalte Bildfläche. Wir können dann sagen
wir verstehen diese Teile des Bildes nicht. Es
kann sein, daß die räumlichen Gegenstände die
dargestellt sind uns bekannt sind
d.h. [f|F]ormen sind die wir aus der
Anschauung von Körpern her kennen, es können aber auch
Formen auf dem Bild dargestellt sein die wir noch nie gesehen
haben. Und da gibt es wieder den Fall wo etwas
ˇz.B. wie ein Vogel aussieht nur nicht
wie einer dessen Art ich kenne oder aber wo ein räumliches
Gebilde dargestellt ist desgleichen ich noch nie gesehen habe.
Auch in diesen diesem letzten Fällen
Fall kann man von einem Nichtverstehen des Bildes reden aber in
einem anderen Sinne als im ersten Fall.
| | |
| | | | | | Man könnte – analog
früheren Erklärungen – sagen:
Das Bild verstehen heißt, im Stande sein es
plastisch nachzubilden.
Aber was heißt
„im Stande sein”? Wenn es nicht heißt das Bild
tatsächlich so nachzubilden so ist eben diese
Nachbildung für das Verständnis nicht nötig
& was wesentlich ist muß das Andere sein was
mich sagen macht ich sei im Stande das Bild plastisch
darzustellen.
| | |
| | | / | | |
Aber noch etwas: Angenommen
das Bild stellte Menschen dar wäre aber klein & die
Menschen darauf etwa einen Zoll lang. Angenommen nun
es gäbe Menschen die von diese Länge hätten
so würden wir sie in dem Bild erkennen &
es würde uns nun einen ganz anderen Eindruck machen obwohl doch
die Illusion der dreidimensionalen Gegenstände ganz dieselbe
wäre. Und doch ist Eindruck wie er da ist unabhängig davon
daß ich tatsächlich einmal Menschen in der gewöhnlichen
Größe & nie Zwerge gesehen habe wenn auch dies die
Ursache Eindrucks ist.
| | |
| | | / | | | Dieses
[s|S]ehen der gemalten Menschen als Menschen (im
Gegensatz etwa zu Zwergen) ist ganz Sehen als als
3-dimensionales Gebilde [ … ganz analog dem Sehen der Malerei
als Gruppierung 3-dimensionaler
Gebilde ] Wir können
hier nicht sagen wir sehen immer dasselbe & fassen
es ˇnachträglich einmal als das das eine
& einmal als jenes das andere auf
sondern wir sehen jedesmal etwas [a|A]nderes.
| | |
| | | | | | Und so auch wenn wir einen Satz
mit Verständnis und
ohne Verständnis lesen. (Erinnere
dich daran wie es ist wenn man einen Satz mit falscher
Betonung liest ihn dabei nicht versteht & darauf kommt wie er zu lesen ist.)
| | |
| | | / | | | Ich
ha verstehe dieses Bild genau, ich könnte
es in Ton kneten. – Ich verstehe diese
Beschreibung genau ich könnte eine Zeichnung nach ihr
machen.
| | |
| | | / | | |
Das Verständnis des Bildes hat es nur
mit dem Bild zu tun. Das Verständnis des Satzes nur
mit dem Satz.
| | |
| | | / | | |
D[er|as] Satzzeichen verstehen
heißt durch dieses ein Datum zu erhalten das, da es nicht
d[a|e]r dargestellte Sachverhalt ist, noch der Satz
genannt werden kann.
| | |
| | | / | | |
Wenn uns die Definition Verständnis mitteilt, dann
muß hinfort beim hören des erklärten
Worts etwas anderes geschehen als vorher. (Wenn
wir es im Satz hören.)
| | |
| | | | | |
7. Wie vermittelt die
(hinweisende) Definition das
Verständnis der Sprache?
| | |
| | | / | | |
Ich sage
„Wähle alle blauen Kugeln aus”;
er aber weiß nicht was „blau” heißt.
Nun ˇzeige ich & sage ich „das ist
blau”. Nun versteht er mich & kann meinem
Befehl
befolgen.
Ich setze ihn in Stand dem Befehl zu folgen.
Was geschieht nun aber, wenn er in Zukunft diesen Befehl
hört? Ist es nötig daß er sich jener
Erklärung d.h. des
einmaligen Ereignisses jener Erklärung
erinnert? Ist es nötig daß das
Vorstellungsbild des Blauen Gegenstands
oder eines blauen Gegenstands vor seine Seele tritt?
Alles das scheint nicht nötig zu sein, obwohl es
möglicherweise geschieht. Und doch hat das Wort
„blau” jetzt einen anderen Aspekt für ihn als
da es ihm noch nicht erklärt war. (Es
gewinnt gleichsam Tiefe. Er sieht [z|j]etzt
etwas anderes darin.(﹖)
| | |
| | | ∫ | | | E[s|r]
kann dem Befehl folgen heißt nicht er folgt ihm
daß er ihm
folgt |
, es heißt also etwas anderes; und
– ich möchte sagen – die nächste
Verwandschaft die zwei Fakten miteinander haben
können ist daß der eine ein Bild des anderen ist.
| | |
| | | ∫ | | | Oder:
Es nützt auch nichts daß wenn
„[f|F]olgen können”
Bestandteile mit „Folgen” gemein hat; denn
irgendwo fängt die Verschiedenheit an.
| | |
| | | | | | Man könnte ˇes aber
in
gewissen Fällen geradezu
(gleichsam) |
als Bedingung des Verstehens
setzen daß ein M man den Sinn des Satzes
muß zeichnen können. – Wenn ich aber frage:
Woher weißt Du, daß Du den Sinn zeichnen kannst?
(außer es heißt daß Du ihn gezeichnet
hast)
| | |
| | | ∫ | | |
Also, würde man sagen, wird
ein Erlebnis „das Zeichnen” genannt, ein
anderes „das Erlebnis zeichnen zu
können”. – Aber so ist es
nicht.
Vielmehr besteht das
„ˇEs Zeichnen
können” in dem Verstehen
(dessen) was es heißt „es zu
zeichnen”.
| | |
| | | / | | |
Denken wir an das Verstehen einer
Bildergeschichte.
Hier wird übrigens das
Kriterium des Verstehens darin gesehen daß wir die Geschichte nach
den Bildern in Worten erzählen können.
| | |
| | | ∫ | | | Sehen wir uns auch
an, was es heißt eine Partitur zu verstehen. Hier
ˇallerderdings scheint es
allerdin daß, wer sie mit
[v|V]erständnis liest sie hierbei schon
übersetzt indem er das Musikstück etwas vor
sich hinsummt oder entsprechende Bewegungen des Kehlkopfes
macht.
| | |
| | | / | | |
Welche Wirkung hatte nun die hinweisende
Erklärung? Hatte sie sozusagen nur eine
automatische Wirkung? Das heißt aber wird sie
nun immer wieder benötigt oder hatte sie eine
[U|u]rsächliche Wirkung wie etwa eine Impfung die uns ein
für allemal oder doch bis auf weiteres geändert
hat.
| | |
| | | | | | Ist es nicht so,
daß, soweit die Definition uns ein für allemal
Verständnis gegeben hat, sie unsere Sprache geändert hat & daher nur als
Geschichte unseres Verständnisses in
[b|B]etracht kommt, – oder: für uns darum
nicht in Betracht kommt. [ … &
daher nur Geschichte unseres
Verständnisses, logisch aber nicht in Betracht
kommt. ]
| | |
| | | / | | |
Die Definition kommt für uns nur dort
in Betracht wo sie wieder gebraucht wird.
| | |
| | | ∫ / ? | | | Die
Definition wirkt wenn ich den Satz höre „der
Himmel war rot” & frage „was ist
‚rot’” & man zeigt mir zur Antwort
auf ein rotes Papier ich & ich verstehe
diese Erklärung, ˇhätte ich den Satz
(hätte) verstehen
müssen wenn er statt des Wortes
„rot” auf das Papier gezeigt worden
wäre.
| | |
| | | ∫ | | |
Ich kann mir denken daß ein
geübter Kontrapunktiker eine Partitur
ˇz.B. einer Fuge liest ohne sich
Klangbilder zu machen & etwa aus dem Ansehen der Noten allein
einen Genuß bezieht; ganz analog dem den wir beim
lesen einer Beschreibung haben ohne
daß wir uns hiebei die Beschreibung in ein Gesichtsbild
übersetzen. Es ist aber auch kein Zweifel daß der
Musiker wenn er die Partitur anschaut etwas anderes sieht als
etwa ich wenn ich sie ansehe.
| | |
| | | ∫ | | |
Wenn wir (eine
Beschreibung) lesen so steht uns die
der
(in
der Beschreibung) zur Verfügung & was ˇfür
Dispositionen, Bilder etc. diese in
uns hervorrufen. Sonst nichts. Daraus
muß sich das Verständnis rekrutieren.
| | |
| | | ∫ | | |
Ich könnte
bildlich sagen: ich finde in meinem Geist das Wort rot
als Etiquette eines roten
Vorstellungsbildes (vor).
(Bergson)
| | |
| | | / | | | Wenn ich die
Zeichen „~” und
„ ∙ ” verstehe, so
kann ich p ∣ q durch
~p ∙ ~q =
p ∣ q Def erklären. Aber
ich kann nun im Gebrauch der Form ξ ∣ η so weit kommen
daß ich um sie zu verstehen die Übersetzung in
~ξ ∙ ~η
nicht mehr vornehmen muß & dann ist
diese Definition
obsolet geworden & damit gezeigt daß sie von
vornherein nicht unbedingt nötig gewesen
wäre[.|,]
[D|d]enn
alles was nötig war, war die grammatischen Regeln für
ξ ∣ η zu kennen.
| | |
| | | ∫ | | | Ist das nun
nicht auch in dem Falle ähnlich wo wir das Wort
„blau” durch den Hinweis „das ist
blau” erklärten? D.h.
brauchen wir da nicht (auch) nur in ganz bestimmten
Fallen [ für ganz bestimmte
Übergänge ] die ostensive Definition
während im übrigen die Regeln genügen die für das
Wort „blau” gelten?
| | |
| | | | | | Eine Erklärung kann nicht in die Ferne
wirken. Ich meine: sie wirkt nur wo sie angewandt
wird. Wenn sie außerdem noch eine
„Wirkung” hat, dann nicht als
Erklärung.
| | |
| | | / | | |
Das Verstehen des Satzes kann
nicht ˇwesentlich in dem Abbilden in eine andere
Spra-che liegen. Es handelt sich vielmehr um die
„Möglichkeit” dieses Abbildens &
die muß darin liegen wie man den Satz selbst sieht. Wie
die Möglichkeit das gemalte Bild plastisch
abzubilden darin liegt daß man es plastisch sieht.
| | |
| | | ? / | | | Wenn das
Verständnis darin besteht, daß man den Satz abbilden
kann, dann gibt es hier ˇdie zwei Fälle:
Erstens daß ich mich darin irren kann wie in dem Fall wenn
ich sage ich kann 50 kg heben & der Versuch ergibt
daß ich es nicht kann. Oder zweitens daß der Satz
„ich kann …” die Beschreibung einer
Erfahrung ist; daß es also
auch nicht gegen die Wahrheit der Aussage spricht, wenn ich aus
„äußeren Gründen” verhindert
bin an der Ausführung verhindert bin.
| | |
| | | / | | | Das Können
ist dann ein inneres Konnen
(wie ich es nennen könnte) das andere ein
äußeres.
| | |
| | | ∫ | | |
Und mich kann hier nur das innere
Können interessieren, das aquivalent
ist dem Verständnis über das ich nicht im Zweifel sein kann
mich nicht
täuschen kann |
, das nicht
durch eine künftige Erfahrung bestätigt oder
zweifelhaft gemacht werden kann.
| | |
| | | ∫ | | | Man könnte
glei quasi sagen: „Ich
könnte das jetzt zeichnen, wenn ich wollte, & keine
Hindernisse dazwischen kämen.”
| | |
| | | ∫ | | |
Das heißt doch wohl: eine
Bedingung ist dafür gegeben. Und diese Bedingung liegt
in dem was mir
vorliegt. [ … was mir gegeben
ist. ]
| | |
| | | / | | |
Dann aber muß der Satz „ich
kann diesen Sinn zeichnen” eine Aussage darüber sein
daß ich jetzt in ihm eine gewisse Multiplizität sähe also
von der Art: ich sehe die Figur
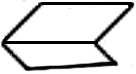 jetzt
plastisch. jetzt
plastisch.
| | |
| | | | | | „Ich
k[önnte|ann]
das zeichnen, wenn nichts mich hindert”: welche
seltsame Verklausulierung. Heißt das nicht:
ich kann, wenn ich kann? Denn es ist ja nicht von der
Art: „ich kann diese Arbeit machen wenn ich nicht krank
werde”. Denn hier habe ich ˇnur eine
äußere Ursache ausgeschaltet & ist das die einzige die
ich ausgeschaltet habe so heißt der Satz: ich werde die
Arbeit machen wenn ich nicht krank werde. In dem oberen
Satz aber habe ich gar nichts vorausgesagt & jedes Hindernis
als solches gelten lassen (denn voraus wissen kann ich ja
nichts) So daß das
„kann” eigentlich jeden Sinn verliert,
wenn mit den Worten die ˇdas beschreiben was ich
kann, nicht die Multiplizität ˇdes Erlebten
gekennzeichnet werden soll.
| | |
| | | ∫ | | | Das Symbol verstehen kann nur
heißen, es kennen.
| | |
| | | ? ∫ | | |
Wir sagen jemanden
„das ist grün,” vergiß
es nicht!”. Nun kommt das Wort „grün”
vor, & er soll danach handeln. Und nun sucht
er sich daran zu erinnern was grü welche
Farbe „grün” genannt war. Aber worin
besteht dieses Suchen? Nachschauen was grün genannt
war. Er drückt etwa auf einen bestimmten Knopf
& was dann hervorspringt ist das gesuchte (wenn etwas
hervorspringt.).
| | |
| | | / ? ∫ | | | Man kann
also auch so sagen: Er ist davon abhängig ob sich
beim Hören des Wortes „grün” etwas –
in bestimmter Weise – meldet.
| | |
| | | ? ∫ | | | Soweit nun die
Definition eben zur Folge hat daß sich etwas
meldet, [ eben das zur Folge
hat,) ist sie nicht Definition sondern
gleichsam ein mechanisches
Hülfsmittel.
| | |
| | | ? ∫ | | | Die Definition heftet
ein Täfelchen mit dem Wort „grün” an
eins Grünes. [ … eins
grüner
Farbe[)| ] ]
| | |
| | | ? ∫ | | | Was heißt es
eine Definition be
benutzen? Heißt es unbedingt, auf die geschriebene
Definition hinschauen?
Heißt es
nicht: ihr gemäß das eine für das andere
setzen? – Denn ist nicht die Einsetzung auch dann
gemäß der Definition, wenn das Zeichen, der Ausdruck, der
Definition nicht angesehen oder vorgestellt
wurde.
| | |
| | | ? ∫ | | |
Und also wäre das, was ich im
vorigen Satz & weiter oben gesagt habe, falsch, & es wäre doch
eine regelrechte Benutzung der Definition wenn mir beim Worte
„grün” in der gewissen Weise der
grüne Fleck einfällt.
| | |
| | | / | | |
Heißt ‚verstehen’
schon: übersetzen, dann muß man nicht verstehen um
übersezen zu können. [ … dann ist das Verstehen keine Bedingung des
Übersetzens. ]
| | |
| | | / | | |
Und da bietet sich uns ein Ausweg an der
aber keiner ist, nämlich: daß die erste Übersetzung
des Verstehens eine automatische ist die dem Verstehen folgende
eine (Jeder solche falsche Ausweg ist
(aber) interessant, denn er böte
sich uns nicht an wenn nicht irgend etwas
richtiges an ihm wäre.)
| | |
| | | / | | | Wenn
[V|v]erstehen nicht [Ü|ü]bersetzen
heißt, dann heißt es das
Zeichen im Raume grammatischen
Regeln sehen.
| | |
| | | / | | |
Man kann der Philosophie keinen
größeren Gefallen tun, als wenn man d[er|ie]
gewöhnliche & irrige Auffassung paraphrasiert
& deutlich hinstellt.
| | |
| | | / | | | Das Schachspiel ist
gewiß einzig & allein durch seine Regeln (sein
Regelverzeichnis) charakterisiert. Ebenso ist es
klar daß einer der eine Partie Schach spielt & jetzt seinen
Zug macht etwas anderes tut als der der nicht Schach spielen kann
(d.h. das Spiel nicht kennt) & nun
eine Figur in die Hand nimmt & sie zufällig so
bewe der Regel gemäß bewegt.)
Anderseits ist es aber ebenso klar daß der Unterschied
nicht darin besteht, daß der erste in irgendeiner Form die Regeln
des Schachspiels vor sich hersagt oder überdenkt. –
Wenn ich nun sage, daß er Schach spielen kann besteht
darin daß er die Regeln kennt, ist diese Kenntnis der Regeln in
jedem Zuge in irgend einer Form enthalten? In gewissem
Sinne, scheint es, Ja! Denn sonst müßte
es erst eine zukünftige Erfahrung ergeben ob er wirklich Schach
spielt
d.h. „er spielt Schach”
wäre dann eine Hypothese die übrigens
deshalb nur durch die Erfahrung bestätigt aber nicht
werden
könnte. Andrerseits scheint in gewissem Sinne kein
Zweifel möglich daß ich Schach spiele & in diesem
Sinne muß das also in dem liegen was jetzt bei meinem Zug
stattfindet.
Es muß also daran liegen
daß ich diesen Zug anders sehe (vergleiche
 ) als der
welcher nicht spielt. ) als der
welcher nicht spielt.
| | |
| | | ∫ | | |
Genau so muß es gehen wenn ich einen Zug
mit den Worten „und” „nicht”
etc. vornehme, einen Satz sage worin sie
vorkommen.
| | |
| | | / | | |
Gefragt was ich mit
„und” im Satze „gib mir das
Brod und die Butter” meine
würde ich mit einer Gebärde antworten &
diese Gebärde würde die Bedeutung [ würde, was ich meine ]
illustrie-ren. Wie das grüne Täfelchen
„grün” illustriert & wie die
W-F-Notation „und” &
„nicht” illustriert.
| | |
| | | ∫ | | | Es
besteht also das Verstehen ˇeines Zeichens
scheinbar darin daß wir in ihm oder mit ihm ein Gebilde von
gewisser Multiplizität sehen die der nicht
verstehende nicht sieht. Das
wesentliche aber hier wäre, daß man
| | |
| | | ? / | | | Das
heißt es gibt einen Sinn in welchem der Satz „ich spiele
Schach” eine Hypothese ist & eine andern in dem
es keine ist.
| | |
| | | ∫ | | |
Wir können alles was wir
wollen von einem behaviouristischen
(scheußliches Wort) Standpunkte auffassen, da es uns ganz
gleich ist was geschieht & wir nur an der
Multiplizität dessen was geschieht interessiert sind.
| | |
| | | | | | Nun [K|k]önnte man
nämlich sagen: Wenn so
complizierte Vorgänge beim Verstehen
des Wortes „und” eine Rolle spielen & das
Verstehen etwas für uns
wesentliches ist, wie kommt es, daß diese
Vorgänge in der symbolischen Logik nie erwähnt
werden? Wie k[ö|o]mmt es daß von ihnen
in der Logik nie die Rede ist noch sein braucht?
| | |
| | | / | | | Das
Verständnis wird nicht nur durch die Erklärungen
hervorgerufen sondern muß
(auch) selbst von der Multiplizität
Erklärungen sein.
| | |
| | | / | | | D.h.
wir können wieder das System der Erklärungen für das
Verstandnis nehmen.
| | |
| | | ∫ ? / | | |
Man könnte auch so fragen: Wer eine Verneinung
versteht, muß der nicht alle Regeln die die die
Verneinung betreffend betreffen kennen?
Also auch diese. Wenn er sie nun gerade nicht
anwendet worin besteht es dann daß er sie kennt?
Ist das nur eine Hypothese eine Disposition?
Dann interessiert sie uns nicht.
Was
heißt es aber alle Regeln über die
Verneinung kennen?
| | |
| | | ∫ | | |
Kann ich sagen: Wenn ich einen
3-di Körper im Gesichtsraum
sehe wahrnehme so liefert er mir
(gewisse) Regeln für das Wort was
ihn bezeichnet.
| | |
| | | ∫ | | |
Oder soll ich nicht vielmehr sagen:
Wenn dieser Körper das Zeichen ist & es ist etwa
eine seiner Flächen ein anderes Zeichen so sind damit die Regeln
gegeben die die beiden verknüpfen.
| | |
| | | / | | |
9. Erinnere dich
daran wie schwer es Kindern fällt zu glauben (oder
einzusehen) daß ein Wort wirklich zwei
ganz verschiedene Bedeutungen .
| | |
| | | / | | |
Ein unartikuliertes Verständnis
ist für uns kein Verständnis. [ … nennen wir nicht
‚Verständnis’. ] 5
| | |
| | | / | | |
Was immer den Satz
unartikuliert be-gleitet interessiert uns nicht.
| | |
| | | ∫ | | | „Geh' in 5
Minuten aus dem Zimmer! hast Du verstanden?”
Ja, ich soll in 5 Minuten (auf die Uhr zeigend) aus dem
Zimmer gehen (auf die Tür weisend). Ich werde
Dir vormachen was ich
werde. Also, wenn der Zeiger hier steht werde ich es so
machen (Er führt es vor). – Nun wird man sagen hat er dennoch nicht daß er es verstanden hatte, und ich sage daß
er alles gezeigt hat was da war.
| | |
| | | / | | | Es ist eine
⋎ Auffassung daß er gleichsam nur unvollkommen zeigen
kann ob er verstanden hat. Daß er gleichsam nur immer
aus der Ferne darauf deuten ˇauch sich ihm nähern es aber
nie mit der Hand
kann. Und das letzte immer ungesagt
bleibt. [ bleiben muß. ]
| | |
| | | / | | | Man will
sagen: Er versteht es zwar ganz kann es aber nicht ganz
zeigen da er sonst schon tun müßte was ja erst in
Befolgung des Befehls geschehen darf. So kann er es also
nicht zeigen daß er es ganz versteht.
D.h. also er weiß immer mehr als er zeigen
kann.
Aber so ist es nicht. Er
weiß nicht mehr als er zeigen kann. Und nur was er
zeigen kann das weiß er.
| | |
| | | / | | |
Man möchte sagen:
Er ist mit seinem Verständnis beim
der Tatsache [ bei der
Ausfuhrung ] aber die
Erklärung kann nie die Ausführung ent-halten.
Aber
das Verständnis enthält nicht die Ausführung sondern
ist nur das Symbol das bei der Ausführung übersetzt
wird.
| | |
| | | / | | |
Unsere Frage durfte nicht lauten
„was heißt es einen Satz verstehen”, sondern
„was heißt es, ihn so zu
verstehen”. Denn die Erklärung
entspricht diesem Verständnis ˇ(dieser
Deutung) & nicht dem Verständnis
überhaupt.
| | |
| | | / | | |
Wenn ich sage, alles
Verstandnis entspricht einer Erklärung
& es gibt kein Verständnis das nicht // durch Erklärung erzeugt //
erklärt |
werden könnte, so meine ich mit
‚Verständnis’ das So-Verstehen
(im Gegensatz zum anders Verstehen) Aber
nicht das Verstehen überhaupt (im Gegensatz zum
nichtverstehen
d.h. nicht
als Satz auffassen.)
| | |
| | | / | | |
Dem aber entspricht keine
Erklärung.
| | |
| | | | | | Was heißt
es dann aber einen Satz überhaupt (als
solchen) zu verstehen?
| | |
| | | / | | | Das Verständnis
nicht die Erklärung geben kann, kann die
Sprache nicht geben.
| | |
| | | | | | Aber
wenn es eine Erklärung dieses Verständnisses
(d.h. des Vorgangs dieses
Verständnisses) gäbe, so müßte es auch eine
(sprachliche) Unterweisung darin
geben. (also eine Erklär[ü|u]ng im ersten
Sinn
| | |
| | | ø | | | Was
ich ‚verstehen’ nenne, wenn ich z.B. in einem Witzblatt eine Bildergeschichte
sehe worin ein Radfahrer auf einer Straße fährt ist nicht,
daß ich mir nun einen solchen wirklichen Radfahrer in der Phantasie
eigens vorstelle, sondern ich gebe mich mit dem zufrieden was ich auf
den Bildern sehe, wenn ich es auch anders sehe als einer der
keinen Radfahrer je gesehen hat. „Ah ja, da ist
ein Radfahrer” sage ich &
dok[o|u]mentiere damit mein Verständnis.
| | |
| | | / | | |
10.
Wir haben gesagt Verständnis entspricht der Erklärung,
soweit es aber der Erklärung nicht entspricht, ist es
unartikuliert & geht uns deswegen nicht an,
oder es ist artikuliert & entspricht dem Satz selbst dessen
Verständnis wir beschreiben wollten.
| | |
| | | / | | | Die Frage um die
es sich handelt ist eigentlich: Sind die Vorgänge
beim Verstehen (Denken) beschrieben, wenn ich sage, daß es
gewisse Vorstellungen sind etc; oder
ist außer diesen Vorstellungen, welcher Art sie auch
sein mogen, noch etwas weiteres
anderer Art, was man die Interpretation nennen
, vorhanden.
| | |
| | | | | | Ich müßte aber dann sagen:
Denken ist keine abgeschlossene Tatsache, von welcher Art
immer. Denn ‚Art’ muß hier logische
Art heißen.
| | |
| | | ∫ | | |
Denn ist das erste der Fall, so können
wir, da uns die besondere psychologische Art der
Vorgange gar nicht interessiert, an ihrer
statt irgend welche anderen (etwa die auf einer
Schreibtafel) betrachten. Und dann ist der
Einwand, daß dieses Tote kein Denken ist. Und wir
weiter, daß nur
das lebende Wesen denkt. Aber damit führen wir unsere
ad absurdum.
Denn wir haben es doch gewiß nicht mit dem Leben oder dem
Unterschied zwischen Totem & Lebendem zu tun.
Vielmehr handelt sich's offenbar um den Unterschied
primär &
secundär. Und um die
Idee, daß etwas denkt. Denn es fällt uns
gleich der Einwand ein: Eine Maschine kann doch nicht
denken. Aber der Gedanke im primären Sinn
enthält kein Subject.
(„Es denkt”)
| | |
| | | ø | | |
(Einen von
der Wahrheit zu überzeugen, genügt es nicht die
Wahrheit zu constatieren, sondern man muß den
Weg vom Irrtum zur Wahrheit finden.)
| | |
| | | ø | | |
(Man muß beim Irrtum ansetzen und ihn in die Wahrheit
überführen.)
| | |
| | | ø | | |
(D.h. man muß die Quelle des
Irrtums aufdecken, sonst nützt uns das Hören der Wahrheit
nichts. Sie kann nicht eindringen etwas anderes ihren Platz einnimmt.
| | |
| | | / | | | Ich sage:
Das Verstehen bestehe darin, daß ich eine bestimmte
Erfahrung habe. –
Daß diese
Erfahrung aber das Verstehen dessen ist, ⌊–⌋ was ich verstehe –
darin, daß diese Erfahrung
ein Teil meiner
Sprache ist.
| | |
| | | ? / | | |
Daß ein Satz ein Satz ist,
besteht nicht darin, daß ich das mit ihm meine, sondern
daß ich mit ihm ; daß ich das mit ihm
meine muß aus ihm hervorgehen.
| | |
| | | / | | | (Da scheinen
wir nun auf etwas Transcendentes zu
stoßen. Und sind zu einer besonders intensiven
Introspection geneigt.)
| | |
| | | / | | | Könnten wir
etwas Sprache nennen, was nicht wirklich angewandt
würde? Könnte man von
Sprachen
reden, wenn nie eine gesprochen worden wäre? (Ist
denn Sprache ein Begriff wie Centaur, der
besteht, auch wenn es nie ein solches Wesen gegeben hat?)
| | |
| | | / | | |
Sprache läßt sich nur mit ˇder
Sprache beschreiben, darin liegt die Lösung des
Rätsels.
| | |
| | | | | | Wenn ich
sage: „Was Sprache heißt, läßt sich
nicht erklären”, so ist das natürlich
ausgedrückt. (Denn
wäre ein Problem, so wäre auch eine
Erklärung.) Vielmehr läßt sich das
Phänomen der menschlichen Sprache sehr wohl
beschreiben & auch erklären. ‒ ‒ ‒
| | |
| | | | | | Die Sprache ist einzig, darum kann sie
nicht erklärt werden.
| | |
| | | ∫ | | |
Die Sprache muß sich selbst
zeigen.
| | |
| | | ∫ | | |
Kann man sagen: Wir glauben, daß die Sprache
außer sich deutet, weil sie einmal in etwas
anderes übersetzt wird? Aber was heißt
es, das zu wissen? Wenn ich sage: ich weiß,
daß die Worte ‚gehe aus dem Zimmer’ in die
Handlung ‚aus dem
Z.
gehen’ übersetzt wird, was weiß ich?
| | |
| | | ∫ | | | Ich
unterscheide hier scheinbar zwischen dem Symbol & dem
Sinn.
| | |
| | | ∫ | | |
Der Sinn wäre eben dieses Wesen auf das man nur mit Symbolen
deuten, das man aber nie erreichen kann.
| | |
| | | ∫ | | | (Man wird in dieser
Untersuchung immer durch Irrlichter
verführt)
| | |
| | | ∫ | | |
Ich sage ihm „geh' aus
dem Zimmer” & er geht aus dem Z. Das kann ausgedrückt werden
durch: Ich sage „geh …” &
er tut es.
| | |
| | | ∫ | | |
Es hat nun einen Sinn zu sagen:
Ich sage ihm „geh' …” & er
übersetzt es in die Tat. Aber daß ich das
nun nicht anders erklären kann als durch Wiederholung
desselben [s|S]atzes, das zeigt die Grenzen Ausdrucksfähigkeit, die Grenzen der
Sprache.
| | |
| | | ∫ | | |
Wenn ich sagen würde: ich nenne nur das eine
Übersetzung von ‚p’, wenn er
p tut, so heißt das natürlich p im Gegensatz zu
[p|q].
| | |
| | | ∫ ? / / | | |
Aber ist es nicht möglich
kann es
nicht sein |
, daß
ˇwir﹖ ‚p’ &
‚q’ haben, es aber unmöglich ist zu
erklären, welche Handlung ich mit
‚p’, welche ich mit
‚q’ meine?
Oder:
Ist es nicht möglich, daß wir beide Wörter
‚blau’ & ‚rot’ haben
& verschiedenes damit meinen, es aber unmöglich
ist zu erklären, welches wir mit dem einen, welches wir mit dem
andern meinen? – Nein. Die
Erklärung ist äquivalent mit der Bedeutung.
| | |
| | | / | | |
Die
Grenze der Sprache zeigt sich in der Unmöglichkeit die Tatsache
zu beschreiben, die dem Satz
gemäß ist
einem Satz entspricht |
(seine Übersetzung ist) ohne eben
den Satz zu wiederholen.
| | |
| | | / | | |
(Wir haben es hier mit der
Kant'schen Lösung des
Problems der Philosophie zu tun.)
| | |
| | | | | | Man könnte eine wesentliche Frage auch so
stellen: Wenn ich jemandem sage „male
diesen Kreis rot”, wie entnimmt er aus dem Wort
‚rot’ welche Farbe er zu nehmen hat?
| | |
| | | / | | | Man kann nicht
das Zeichen durch Zwischenschaltung von Zeichen
erklären.
| | |
| | | / | | |
Wie soll er wissen welche Farbe er zu
wählen hat, wenn er das Wort ‚rot’
hört? – Sehr einfach: er soll die Farbe
nehmen deren Bild ihm beim hören des
Wortes einfällt. – Aber wie soll er wissen,
was die ‚Farbe’ ist, ‚deren Bild ihm
einfällt’? Braucht es dafür ein
weiteres Kriterium? u.s.f.
| | |
| | | | | |
Wie weiß er, welche Farbe er bei dem Wort
‚rot’ zu wählen hat? – Weil
es ihm erklärt worden ist.
Und soweit
diese Erklärung als Erklärung wirkt, hat sie die
Multiplizität des Verständnisses.
| | |
| | | / | | | Es gibt kein
Kriterium, kein Symptom, dafür, daß diese Farbe Rot
ist.
| | |
| | | ∫ ? / \ | | |
Rot ist
die Farbe die ich in das Wort ‚rot’
übersetze. Aber was heißt es etwas in das Wort
… zu übersetzen?
| | |
| | | ∫ ? / \ | | |
Es heißt
sich einen Symbolismus
eine Sprache |
zurechtlegen wie wir es machen, wenn wir uns etwas notieren wollen,
uns etwa eine Methode ⋎ ausdenken & nun die
erste entsprechende Notiz machen.
Ich sage mir etwa: Wenn ich
M auf der
Straße treffe, werde ich mir in meinem Kalender zu diesem Tag ein
Kreuz machen: Heute beginne ich nun damit, so bin
ich bereits bei diesem Mal der
heute dieser |
Regel
gefolgt,
d.h.,
hätte ich
ih[m|n] heute nicht begegnet sondern
erst morgen, so wäre beim heutigen Tag kein Kreuz, wohl aber beim
morgigen.
(Diese Sprache hat für
unsere Betrachtung den Vorteil, daß ich sie erfunden habe
& ich allein sie verstehen soll.)
| | |
| | | / | | |
11.
Der Satz, wenn ich ihn verstehe, bekommt für mich
Tiefe.
| | |
| | | / | | | Wenn ich sage
„zeichne einen Kreis an der Wand”, so zeige ich von
mir zur Wand & ist das nicht das Vorbild jenes
nach-außen-Weisens des
Satzes?
| | |
| | | / | | |
Man würde etwa
(so) sagen: Ich sage ja
nicht nur „zeichne einen Kreis”, sondern ich
wünsche doch, daß der Andre etwas tut.
(Gewiß!) Und dieses Tun ist doch etwas
anderes als das
[s|S]agen &
ist eben das Außerhalb worauf ich weise der Satz
wei[ß|s]t.
| | |
| | | / | | |
Jedes Symbol scheint als solches etwas
offen zu lassen.
| | |
| | | ø | | |
(Ich muß immer wieder im Wasser des
Zweifels untertauchen.)
| | |
| | | ∫ | | |
Aber was läßt denn der Satz
„zeichne …” offen? Nun, daß
der Andre zeichnet, oder nicht zeichnet.
| | |
| | | / | | | In
wiefern kann man den Wunsch
‚unbefriedigt’ nennen? Was ist das
der Unbefriedigung? Ist
es der leere Hohlraum (in den etwas
hineinpaßt)? Und würde man
von einem leeren Raum sagen er sei unbefriedigt?
Wäre das nicht auch eine Metapher? Ist
es nicht ein gewisses Gefühl, das wir Unbefriedigung
nennen? Etwa der Hunger. Aber der Hunger
enthält nicht das Bild seiner Befriedigung. Ist also
unser Urbild der Unbefriedigung etwa der leere Magen
& der Hunger?
| | |
| | | / | | | Ich könnte mir
vorstellen: Wenn ich Hunger habe, öffne ich meinen
Mund & der offene Mund ist nun (quasi) ein
Symbol der Unbefriedigung. – Aber warum ist er allein
n⌊i⌋cht unbefriedigt noch auch der Hunger allein?
| | |
| | | / | | |
Wieder: Der offene Mund ist nur als Teil einer Sprache
unbefriedigt. Oder soll ich sagen: Nur als Teil
eines Systems das auch die Befriedigung enthält.
| | |
| | | / | | | Die Hohlform ist
nur unbefriedigt in dem System in dem auch die
entsprechende Vollform vorkommt. [ … in dem auch die Vollform vorkommt. ]
| | |
| | | ∫ / \ | | |
Was heißt das
aber: „in einem System etc etc” wie kann man denn so ein
System beschreiben?
| | |
| | | | | | Das
heißt man kann des Wort „unbefriedigt”
nicht schlechtweg von einer Tatsache gebrauchen. Es
kann aber in einem ⋎ System eine Tatsache
beschreiben helfen. Ich könnte
z.B. , daß ich den Hohlzylinder den unbefriedigten
Zylinder nennen will, den entsprechenden Vollzylinder seine
Befriedigung, & daß so eine Notation
möglich ist, ist natürlich für das System
charakteristisch. Daß man also sagen kann:
„Er sagte ‚p’ ist
der Fall’ & so war es”.
| | |
| | | ∫ | | | Ich
könnte sagen: Der Wunsch ist nicht befriedigt
& zeichnet seine eigene Befriedigung vor. – Ja
nur dadurch können wir sagen daß er unbefriedigt
ist. – Und gewiß, der Wunsch daß p der
Fall sein möge zeigt
uns, daß er befriedigt wäre, wenn p der Fall
wäre. Und was sonst können wir mit jenem
Vorzeichnen meinen.
| | |
| | | / | | |
Aber man kann nicht sagen, daß der
Wunsch ‚p möge der Fall sein’ durch die
Tatsache p befriedigt wird. Denn hat das erste
p schon einen Sinn, dann sagt es das schon selber; hat es
aber noch keinen, dann war der
erste Ausdruck
das erste |
noch kein Wunsch & der Satz kommt
einer Zeichenerklärung gleich, [ … hat es aber
noch keinen, dann kommt der Satz einer Zeichenerklärung
gleich, ] die übrigens hier ein Zeichen durch sich
selber also nichts erklärt.
| | |
| | | ∫ | | | „Der Wunsch daß
er hereinkommt & die Tatsache daß er hereinkommt sind
(doch) verschieden”.
Aber das kann man nicht sagen. Was man sagen will, zeigt
die Sprache.
| | |
| | | | | |
12. Rechtmäßiger Gebrauch des Wortes
‚Sprache’: Es bedeutet entweder die
Erfahrungstatsache daß Menschen reden (auf gleicher Stufe
mit der, daß Hunde bellen) oder es bedeutet:
festgesetztes System von Wörtern und gramm.
Regeln
der Verständigung |
in den Ausdrücken „die englische
Sprache”, „deutsche Sprache”,
„Sprache der Neger” etc.
‚Sprache’ als logischer Begriff
könnte nur mit ‚Satz’
aquivalent & dann Überschrift eines Teiles der Grammatik sein.
Soll es aber gar die Überschrift der ganzen
Grammatik sein, so ist es überhaupt kein Wort &
nicht zu verwenden.
| | |
| | | / | | |
Wenn ich sage „die Sprache ist
einzig”, so heißt das eben, daß
‚Sprache’ hier kein Wort ist, d.h. sich so nicht anwenden
läßt.
| | |
| | | / | | |
Was ich zum Beweis meines
Verständnisses zeigen kann, kann mein Verständnis auch ganz
ausdrücken.
| | |
| | | / | | |
Das sieht man, glaube ich, klar, wenn man
einen Befehl, etwa in anderer Form, wiederholt um zu zeigen, daß man
ihn verstanden hat.
| | |
| | | / | | |
Wenn man das Problem des
Verständnisses überdenkt, so meint man, immer, es
müsse einem doch beim Verstehen zu wenig sein, bloß einer
Vorstellung (oder dergleichen) habhaft zu werden.
Aber wie man denn mehr
wollen?!
| | |
| | | / | | |
Das was einen befriedigt ist freilich
nicht die Vorstellung selbst sondern ihre Stellung zu uns.
| | |
| | | / | | | Gleichsam
die Richtung in der sie liegt.
| | |
| | | / | | | Das Bild das mit dem
Verständnis kommt, muß Teil einer Bildersprache sein.
| | |
| | | / | | | Ich
erkläre jemandem einen Plan & wie er zu gehen hat
& sage, auf eine Stelle des Planes zeigend:
„Hier stehen wir; du gehst …” Nun
sieht er die Karte anders.
| | |
| | | / | | |
Verstehen ist nicht: ein Bild sehen,
sondern, ein Bild in einer bestimmten Position.
| | |
| | | / | | | Kann ich
sagen:, das Drama hat seine eigene [z|Z]eit
die nicht ein Abschnitt der historischen Zeit ist.
D.h. ich kann in ihm von früher und
später reden, aber die Frage hat keinen Sinn ob die
Ereignisse, etwa, vor oder nach
Cäsars Tod
geschehen sind.
| | |
| | | / | | |
Jemand befiehlt mir: „geh
über den Great Court”.
Ich verstehe den Befehl & sehe mich im Geiste
dabei über den Gt.
Ct. gehen.
Aber wie kann ich das Bild, was ich da sehe
‚mich’ nennen, ‚wie ich über etc’? Hier
bestimmen ja scheinbar die Worte das Bild, nicht das Bild
die Worte. Aber es könnte ja statt der Vorstellung
auch ein Stich verwendent werden. Ich sage nun,
auf das Bild zeigend: „Das ist der Gt. Ct.” Damit empfinde ich es anders als
wäre es für mich nur das Bild irgend welcher
Gebäude. Das besteht darin, daß ich es mit der
gegenwärtigen Realität in Zusammenhang bringe.
Ich sitze etwa in meinem Zimmer & nun ist es als wäre
das Bild & mein Zimmer auf einem
Plan.
| | |
| | | ∫ / | | |
Wer den Auftrag
‚geh dorthin’ g versteht,
muß dabei seine gegenwärtige Lage verstehen.
Ich meine, er muß die gegenwärtige Lage sehen
& die Relation der beiden Lagen.
| | |
| | | / | | | Wenn ich mit verbundenen
Augen die Richtung verloren habe & man mir nun sagt: geh
dort & dort hin, so hat dieser Befehl keinen Sinn für
mich.
| | |
| | | / | | | Gibt es nicht
einen Raum „der bekannten
Gegenstände”? So daß, wenn alles um uns
sich fortwährend bewegte – alle
Gestallten sich fortwährend auflösten wie
Nebelschwaden – wir in einer anderen Art von physikalischem Raum
wären?
| | |
| | | ∫ | | |
Um das Bild als Bild des Gt.
Ct.
anzuerkennen, muß ich selbst auch darauf sein.
| | |
| | | / | | | (Der Plan kann
mich nur leiten, wenn ich auch auf dem Plan bin.)
| | |
| | | / | | |
13.
Aber wie immer, wer den Plan erklärt gibt weitere
Zeichen.
Und wer ih[m|n] versteht faßt sie
auf.
| | |
| | | / | | |
Das Verstehen des Befehles kann zur Ausführung keine andere
Beziehung haben als eben eine Tatsache zu einer völlig
anderen.
| | |
| | | / | | |
„Dasselbe was ich jetzt
getan habe, wollte ich vor fünf
Minuten” Was ich damals getan habe
heißt eben „wollen was ich jetzt getan
habe”.
So wird die Sprache
gebraucht.
| | |
| | | ∫ / | | |
Laß dich doch von der
Sprache belehren wie der Ausdruck „das &
das wollen” gebraucht wird. (Laß dich
doch von der Sprache ˇdarüber belehren, wie
die Worte „Zahnschmerzen haben”
gebraucht werden)
| | |
| | | ∫ | | |
Wenn immer ich etwas Sinnvolles sage,
so entpuppt es sich eben als etwas Unwesentliches.
| | |
| | | / | | | Man möchte
fragen: Welcher außerordentliche
Prozess muß das Wollen sein,
daß ich das wollen kann, was ich erst in fünf Minuten tun
werde??
| | |
| | | ∫ | | |
(Ich tue ja nichts als das
Gesicht immer wieder & wieder
portraitieren)
| | |
| | | / | | |
Die Antwort ist: Wenn Dir das
sonderbar vorkommt so vergleichst Du es mit etwas womit es nicht zu
vergleichen ist. – Etwa damit: Wie kann
ich jetzt dem Mann die Hand geben, der erst in 5 Minuten hereintreten
wird? Oder ˇetwa gar: wie kann ich dem die
Hand geben, den es vielleicht gar nicht gibt?)
| | |
| | | / | | | Das
‚foreshadowing’ der Tatsache besteht
offenbar darin das wir ˇjetzt denken können, daß
das eintreffen wird was erst eintreffen
wird. Oder, wie das irreführend
ausgedrückt wird: daß wir an das denken
können, was erst eintreffen wird.
| | |
| | | | | | „Wir können jetzt schon
an das denken, was erst später eintreffen
wird” Und so wird der
⋎ Schein erzeugt als wäre eine
Sache zugleich hier & nicht hier.
| | |
| | | / | | | „Der Befehl nimmt
die Ausführung voraus”. In
wiefern nimmt er sie denn voraus?
Dadurch, daß er , was später
ausgeführt (oder nicht ausgeführt)
wird. Oder: Das was wir damit meinen
wenn wir sagen der Befehl nimmt die Ausführung voraus ist
dasselbe was dadurch ausgedrückt ist, daß
der Befehl befielt was später geschieht.
Aber richtig: „geschieht oder nicht
geschieht”. Und das sagt nichts.
(Der Befehl kann sein Wesen eben nur zeigen.)
| | |
| | | ∫ | | | Nur die Anwendung
der Sprache kann zeigen wie sie angewandt ist.
| | |
| | | ∫ | | | „Der Befehl nimmt
das voraus”, : das klingt sehr
außergewöhnlich
außerordentlich |
& ist ganz gewöhnlich.
| | |
| | | / | | | Ich sage: Hier
ist zwar nichts rotes um mich aber wenn hier etwas
ˇrotes wäre, so
könnte ich es erkennen. – Hier sage ich
offenbar etwas über den gegenwärtigen Zustand aus da es
nicht von der weiteren Erfahrung abhängt ob ich Recht
hatte zu sagen daß ich rot erkennen kann.
Ich Im Gegenteil, es läßt sich gar nicht
durch eine weitere Erfahrung bestätigen.
| | |
| | | / | | | Man kann auch
nicht sagen: Wenn jetzt nichts rotes
um Dich ist so hat doch der Satz der das sagt nur Sinn wenn Du einmal
etwas Rotes gesehen ha⌊s⌋t. Auf die
Geschichte meiner Begriffe kommt es nicht an. Hat es Sinn
das Wort „rot” zu gebrauchen so hat es
Sinn d.h. kann ich es gewissen Regeln
gemäß g⌊e⌋brauchen, dann darf ich es
gebrauchen.
| | |
| | | / | | |
Aber wenn auch mein Wunsch nicht
bestimm bestimmt, was der Fall sein wird, so bestimmt er
doch sozusagen das Thema einer Tatsache ob die nun den Wunsch
erfüllt oder nicht.
| | |
| | | / | | |
Muß er nun dazu etwas
vorauswissen? Nein.
p ⌵ ~p sagt
wirklich nichts.
| | |
| | | / | | |
Wir wundern uns – sozusagen –
nicht darüber daß einer die Zukunft
weiß, sondern darüber daß er
rich überhaupt (richtig oder
falsch) prophezeien kann.
| | |
| | | / | | |
Es ist als würde die bloße
Prophezeiung (gleichgültig ob richtig oder falsch)
schon einen Schatten der Zukunft vorausnehmen. –
Wahrend sie über die
Zukunft nichts wei[ss|ß], und weniger als nichts nicht
wissen kann.
| | |
| | | / | | |
(Es ist mir immer als könnte ich
nachweisen daß das Wort „Gedanke” unrichtig
gebraucht wirdˇwenn ich sage der Gedanke sei unbefriedigt. Daß dann das Wort gleichsam eine Funktion
darstellt. Daß wenn ich sage
es den Gedanken unbefriedigt nenne
ich das Wort sozusagen als Funktion in einem Satz gebrauchen
muß
in dem er zusammen mit etwas Anderem
befriedigt ist. Ich möchte dann sagen, das Wort
wird nicht [A|a]bsolut sondern relativ
gebraucht.)
| | |
| | | ∫ | | |
Ich sage „ich wollte dieser Tisch
wäre so hoch” & zeige dabei mit der Hand eine
Höhe an. Nun sagt man: Es kann doch dieser
Wunsch nicht (einfach) darin bestehen
daß ich diese Höhe mit Sehnsucht betrachte.
Ich wünsche doch eben daß dieser Tisch
so hoch wäre; also muß doch die Tatsache des
Wunsches das Gewünschte ganz & gar bestimmen.
Gewiss und wenn ich sage „ich
wünsche dieser Tisch wäre so hoch” so läßt
das ja auch gar keinen Zweifel übrig der etwa durch das bloße
andeuten der Höhe über d mit der Hand
über dem Tische geblieben wäre. Eben weil
die Wortsprache über die genügende Multiplizität
verfügt, um einen Zweifel auszuschließen, da
wir etwas Anderes anders sagen
würden.
Dann heißt aber dieses
Vorausnehmen der Tatsache nur: er darf
keinen Zweifel offenlassen was gemeint ist. Aber wie macht
er denn das? Er muß alles enthalten wovon die Rede ist
(ist von diesem Tisch die Rede [vo|so]n ist
dieser Tisch Teil des Symbols) & in einem System von solcher Multipl. sein
die
Multiplizität haben |
um sich
von jedem Satz zu unterscheiden, der
unterscheiden zu können, der |
etwas anderes
sagt.
| | |
| | | ∫ | | |
Aber warum soll dann nicht die über dem Tisch erhobene Hand
den Wunsch ausdrücken können?
| | |
| | | | | | Sie kann ihn ausdrücken. Ob sie ihn
aber ausdrückt hängt davon ab ˇob wir ich
ihn dadurch ausgedrückt haben habe, ˇd.h.
ob wir das als Sprache festgesetzt haben.
Das
Kreuz in meinem Kalender kann ausdrücken daß
ich heute eine Vorlesung halten soll wenn ich es dazu
bestimme. Durch eine Beliebige
einmalige Zuornung dieses Zeichens zu meiner
Vorlesung wird es nicht zu diesem Ausdruck.
| | |
| | | ∫ | | |
Was ist aber der Vorgang dieses Festsetzens
einer Ausdrucksweise.
| | |
| | | ∫ | | |
14. Ein Ausdruck muß
Teil einer Ausdrucksweise sein.
| | |
| | | ∫ | | | Der Ausdruck des
Wunsches enthält den Wunsch & ist nicht
eine Ubersetzung des Wunsches oder ihm
irgendwie zugeordnet.
| | |
| | | ∫ | | |
D.h.: der Wunsch
selbst ist artikuliert.
| | |
| | | ∫ | | |
Der Ausdruck des Wunsches ist nicht eine
nachtragliche Kundgebung des Wunsches der
schon früher unausgedrückt da war.
Wir wünschen durch – oder in – diesem
Ausdruck wie wir in  ein
Gesicht sehen. ein
Gesicht sehen.
| | |
| | | / | | |
Der Ort Wortes in der Sprache ist seine
Bedeutung.
| | |
| | | ∫ | | |
(Das erinnert an
James's „man
weint nicht weil man traurig ist, sondern man ist traurig weil man
weint”. Was natürlich auch eine
irreführende Darstellung ist.)
| | |
| | | / | | | Man kann den Wunsch nicht
durch etwas anderes ersetzen was nicht Wunsch
ist; und sich dann wundern daß es
Wunsch ist.
| | |
| | | / | | |
Wenn ich frage: worin besteht es, zu
wünschen, der Tisch wäre so hoch & und gebe nun eine
Antwort; etwa die es bestehe darin die Hand über den Tisch zu
halten etc etc.
so habe ich doch das was
ich erklären wollte durch etwas anderes ersetzt. Und
wie soll dieses Andere dessen Ausdruck in der Sprache
neben dem zu erklärenden besteht das Wünschen
erklären?
| | |
| | | / | | |
Denn ‚erklären’
kann hier wieder nicht heißen: Verborgenes ans Licht
zu ziehen – da hier nichts verborgen ist.
| | |
| | | / | | | Man kann wieder nur die
Grammatik des Wortes „wünschen” explizit
machen. (Und so des Wortes „denken” etc.)
| | |
| | | | | | Ein
Pfeil zeigt in einer bestimmten Richtung
& auch wieder nicht.
| | |
| | | | | | Man kann nicht absichtlich ˇoder
unabsichtlich mit [a|A]bsicht übersetzen.
| | |
| | | / | | | Wenn
die Sprache auf einer Übereinkunft beruht, so muß doch diese
Übereinkunft wieder durch Zeichen also Sprache geschlossen sein
& daher beruht die ˇgesamte Sprache nicht
auf Übereinkunft.
| | |
| | | / | | |
Es scheint
(nämlich), daß das Wort
‚Wunsch’, ‚Gedanke’ etc. nur manchmal einen Vorgang, eine
Tatsache zu bezeichnen gebraucht wird, manchmal aber anders;
gleichsam als unvollständiges Symbol durch ein anderes
ergänzt.
| | |
| | | ∫ | | |
Angenommen ich deute jemandem mit der Hand
über dem Tisch an, um wieviel höher er ihn machen
soll. „Was meinst Du wenn Du das Zeichen
machst?”
– Ich meine, daß er de[r|n] Tisch so
hoch machen soll. – Nun scheint es hier etwa als
müßte ich eigentlich sagen: Ich meineˇ mit der
Gebärde, was ich mit den Worten meine „ … ” meine. Und daß
käme darauf hinaus, daß der Sinn immer nur als
der Sinn dieses Zeichens beschrieben werden könnte,
(daß) wir ihn nie selbst
vermitteln können. Als könnte etwa auf
die Frage „wer ist der Vater des A” immer nur
ein Satz von der Form „er ist der Vater des B”
zur Antwort kommen.
| | |
| | | ∫ | | |
Wenn aber ein Wort nur in einem
bestimmten Zusammenhang gebraucht wird, kann es
wegbleiben.
| | |
| | | ∫ | | |
Ein komplizierter Befehl kann durch eine
einfache Handbewegung gegeben werden, wenn alles andere
selbstverstandlich ist.
| | |
| | | ∫ | | | Ich sagte:
Wer den Befehl  versteht, muß, oder müßte, den Befehl
versteht, muß, oder müßte, den Befehl
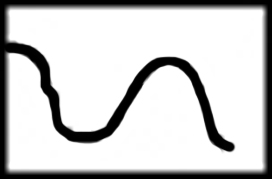 verstehen.
Aber was heißt das „er müßte”.
Das muß offenbar eine Beschreibung dessen sein, was beim
Verstehen des ersten Befehls vorsichgeht. Es war eine Beschreibung dessen was er in
jenem Befehl sieht [ … eine Beschreibung davon,
wie er jenen Befehl auffaßt ] verstehen.
Aber was heißt das „er müßte”.
Das muß offenbar eine Beschreibung dessen sein, was beim
Verstehen des ersten Befehls vorsichgeht. Es war eine Beschreibung dessen was er in
jenem Befehl sieht [ … eine Beschreibung davon,
wie er jenen Befehl auffaßt ]
| | |
| | | ∫ | | | Wenn wir unsere
Aufmerksamkeit auf eine andere Eigenschaft der Kurve richten
so sehen wir etwas anderes.
| | |
| | | | | |
Ich sage, die Hand über den Tisch haltend, „ich
wollte, dieser Tisch wäre so hoch”. Nun ist
das Merkwürdige: Die Hand über dem Tisch an & für sich
drückt gar nichts aus. D.h. sie ist
eine Hand über einem Tisch, aber kein Symbol (wie der Pfeil
der etwa die Gehrichtung anzeigen soll, an sich nichts
ausdrückt.)
| | |
| | | | | |
↦
im Gegensatz zu ↗
ist ein anderes Zeichen als ↦
im Gegensatz zu ⟼.
| | |
| | | / ∫ | | |
Die grammatische Regel beschreibt auch das
Verständnis.
| | |
| | | / | | |
Denn die Frage ist: würde er
dieses Wort auch gebrauch[e|t]n
haben, wenn andere
Regeln davon gälten?
| | |
| | | / | | |
Und wird er sagen, er habe die Zeichen so
verstanden, wenn ich die gramm.
Regeln ändere?
| | |
| | | ∫ | | |
(Nur keine Hypothese
machen!)
| | |
| | | ∫ | | |
Der Knopf im Taschentuch als
Zeichen. Inwiefern kann er mich erinnern, etwas zu
tun.
| | |
| | | / | | |
Die Sc⌊h⌋[h|a]chfigur ist nicht das
Holzklötzchen, sondern der Schnitt gewisser Regeln.
Daher handeln die Regeln nicht von Holz oder Elfenbein.
Sowenig wie die Gesetze der
euklidischen Geometrie von
Graphitteilchen auf auf Papier.
| | |
| | | / | | | So handeln auch die gramm. Regeln nicht von
Tinte.
| | |
| | | / | | |
„Geh so →
nicht so ↗”
hat nur Sinn, wenn es die Richtung ist, die dem Pfeil hier
wesentlich ist, & nicht, etwa nur die Länge.
| | |
| | | | | |
Es wäre unsinnig am Plan der Untergrundbahn
auszusetzen er gehöre so: 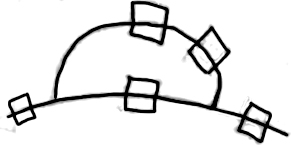 und nicht so: und nicht so:

| | |
| | | / | | | Kann ich nicht sagen:
ich meine die Verneinung welche verdoppelt eine Bejahung
gibt?
| | |
| | | / | | |
Wäre das nicht als würde man
sagen: Ich meine die Gerade, deren zwei sich in einem Punkt
schneiden.
| | |
| | | / | | |
Das heißt: Wenn
Du von Rot gesprochen hast, hast Du dann das gemeint wovon
man sagen kann es sei hell aber nicht grün, auch wenn du an diese
Regel nicht gedacht oder von ihr Gebrauch gemacht hast? – Hast Du das ~ verwendet wofür
~ ~ ~p =
~p ist? auch wenn Du diese Regel nicht
verwendet hast? Ist es etwa eine Hypothese, daß es
das ~ war? Kann
es zweifelhaft sein, ob es dasselbe war & durch die
Erfahrung bestätigt werden?
| | |
| | | / | | | Die Geometrie unseres
Gesichtsraumes ist uns gegeben, d.h. es bedarf
keiner Untersuchung bis jetzt verborgener Tatsachen um
sie zu finden. Die Untersuchung ist keine im Sinn
einer physikalischen oder psychologischen
Untersuchung. Und doch kann man sagen wir kennen
diese Geometrie noch nicht.
| | |
| | | | | |
Man kann sagen, diese Geometrie liegt offen vor uns (wie alles
Logische – im Gegensatz zur
praktischsten
Geo-metrie des physikalischen Raumes)
| | |
| | | ∫ | | | Wie ist es
möglich daß ich, ohne hieran zu denken, das
[b|B]blau
meinen kann, wovon man nicht sagen kann …?
| | |
| | | / | | | Wenn es die
wesentliche Verwendung des Symbols ist übersetzt zu werden, so
kann es kein wesentliches Verständnis [ Verst⌊e⌋hen ] des Symbols geben, das
nicht im Hinblick auf die Übersetzung geschieht.
| | |
| | | / | | | Aber, was
heißt es „in Hinblick” auf die
Übersetzung, wenn diese nicht erfolgt ist?
| | |
| | | / | | | Und wenn wir
sagen, das des Befehls sei
eine andere Übersetzung als die Befolgung, was nützt uns
dann diese ˇandere Übersetzung?
| | |
| | | / | | |
15. Das Element
in der Wortsprache
kümmert uns an & für sich gar nicht,
daß es aber verwendet werden kann um den Sinn deutlich zu
machen ist für uns sehr wichtig.
| | |
| | | / | | | Was heißt es:
verstehen, daß etwas ein Befehl ist, wenn man auch den Befehl
selbst noch nicht versteht? („Er meint:
ich soll etwas tun, aber was er weiß ich nicht.”)
| | |
| | | / | | | Ich verstehe doch
einen Befehl als Befehl, d.h. ich sehe in ihm
nicht nur ein Gebilde, sondern [s|e]s hat – sozusagen
– einen Einfluß auf mich. Ich reagiere auf einen
Befehl (auch ehe ich ihn befolge) anders als etwa auf eine
Mitteilung oder Frage.
| | |
| | | / | | | Es
kann keine ˇnotwendige Zwischenstufe zwischen dem
Auffassen eines Befehls & dem Befolgen geben.
| | |
| | | ø | | |
(Alle Gewohnheiten der Sprache sind gegen Dich.
–)
| | |
| | | | | | Es sagt mir jemand
etwas; nun, wie immer er es meint, ich fasse es
als einen Befehl auf, ohne ˇihn aber noch
auszuführen.
Wie es der Andere
meint, ist für uns überhaupt immer ganz
gleichgültig. Gegeben sind mir ja nur seine
Worte & eventuell seine Gebärden & sein
Gesichtsausdruck, welche aber alle auf gleicher Stufe stehen. – D.h., ich muß sie alle
deuten.
| | |
| | | / | | |
Deuten. – Deuten wir
denn etwas, wenn uns jemand einen Befehl gibt. Wir fassen
auf was wir sehen; oder: wir sehen, was wir sehen.
| | |
| | | | | | Es sei denn das wi[e|r]
„deuten” doch nur auf die Worte beziehen &
sagen: Wir deuten sie mit Hilfe seiner Gebärde, was
dann nur heißt, wir nehmen Worte & Gebärde
wahr.
| | |
| | | | | | Wenn mich jemand
fragt: ‚Wieviel Uhr ist es’,
so geht in mir dann keine Arbeit des Deutens vor. Sondern
ich reagiere unmittelbar auf das, was ich sehe &
höre.
| | |
| | | / | | |
Philosophie wird nicht in
Sätzen sondern in einer Sprache niedergelegt.
| | |
| | | ∫ | | |
D.h. ich fasse
ich fasse diese Worte & Mienen nicht als Befehl
auf weil ich mich dazu entschließe, sondern weil eben das
für mich ein Befehl ist, weil ich das unter einem
Befehl verstehe.
| | |
| | | / | | |
Ich deute die Worte; wohl; aber deute ich
auch die Mienen? Deute ich etwa, einen
Gesichtsausdruck als drohend? oder freundlich? –
| | |
| | | / | | | Wenn ich
nun den früheren Einwand hier geltend machte &
sagte: Es ist nicht genug, daß ich das drohende
Gesicht als Gebilde wahrnehme, sondern ich muß es erst
deuten.
| | |
| | | / | | |
Es zückt jemand das Messer &
ich sage: „ich verstehe das als eine
Drohung”.
| | |
| | | / | | |
Das Subject tritt in
das Verstehen im primären Sinn sowenig ein, wie in das Sehen des
Zeichens.
| | |
| | | ∫ | | |
Ich sehe Aufschriften, die mir etwas
mitteilen & ich sehe Kratzer an der Wand, die
mir nichts mitteilen, obwohl sie mir etwas mitteilen
könnten (d.h. sich so gut die Fähigkeit hätten wie jene
Schriften).
| | |
| | | ∫ | | |
Ich sehe die einen also anders als die
andern (was natürlich (was nat durch
die ihre Vorgeschichte dieser Eindrücke leicht
erklärlich ist). Der Unterschied ist
ausgedrückt durch die Worte „der eine teilt mir etwas
mit, der andre nicht”.
| | |
| | | ∫ | | |
Aber hier ist das ‚etwas’
irreführend, denn es hat nun keinen Sinn zu
fragen: „was?”, da darauf eventuell
dasselbe Zeichen erfolgen müßte. Ich brauchte also
ein intransitives „mitteilen”.
| | |
| | | / | | | Ich sehe eine
deutsche Aufschrift & eine chinesische. – Ist die
chinesische etwa ungeeignet etwas mitzuteilen? – Ich sage, ich habe Chinesisch nicht gelernt.
Aber das Lernen der Sprache fällt als bloße Ursache,
Geschichte, aus der Gegenwart heraus. Nur auf
seine Wirkungen kommt es an & die sind Phänomene die eben
nicht eintreten, wenn ich das Chinesische (warum sie nicht eintreten ist ganz
gleichgültig)
| | |
| | | ∫ | | | Das Lernen der Sprache ist in
ihrem
Gebrauche
ihrer Benützung |
nicht enthalten. (Wie die
Ursache eben nicht in ihrer Wirkung)
| | |
| | | ∫ | | | Das Zeichen plus seinem Sinn
kann man nicht wieder deuten
( den
Gedanken kann man nicht deuten) Das Zeichen
mit seinem Sinn aber (das Symbol) ist ein Phänomen wie das
Zeichen selbst.
| | |
| | | / | | |
Das Festsetzen einer Regel ist die
des
Handelns
nach dieser Regel
der-Regel-Folgens |
. Es fällt aus letzterem
heraus, nicht aber die Regel, die in dem Folgen verkörpert ist
(indem das Folgen durch den Ausdruck der Regel
beschrieben )
| | |
| | | / | | | Ich kann die
Regel selbst festsetzen & mich Sprache lehren. Ich gehe spazieren &
sage mir: Wo immer ich einen Baum treffe
wi soll mir das das Zeichen sein bei der
nächsten Kreuzung links zu gehen, & nun richte ich mich
nach den Bäumen in dieser Weise (fasse ihre Stellung als
einen Befehl auf.)
| | |
| | | / | | |
Das Fassen des Vorsatzes
gehört zur Geschichte seiner Ausführung, dagegen ist
er in seiner Ausführung enthalten.
| | |
| | | ∫ | | | Mein
Gedankengang
Meine
Gedankenbewegung |
:  oder oder
 viel Bewegung, die
nur wenig vorwärts kommt. viel Bewegung, die
nur wenig vorwärts kommt.
| | |
| | | / | | |
„Die Hand zeigt
dahin”: Aber in wiefern
zeigt sie dahin? einfach weil
sie sich in einer Richtung verjüngt? (Zeigt ein
Nagel in die Wand?)
d.h. ist es
dasselbe zu sagen „sie zeigt etc” „sie verjüngt sich in dieser
Richtung”?
| | |
| | | ∫ | | |
„Aber das Zeichen sagt mir doch
was, es gibt mir Information!” Da es mir nichts
anderes zeigen kann als sich selbst & was
es die Eindrücke die es , so kann es mir auch nicht mehr geben.
Das was es mir sagt ist nicht etwas außerhalb worauf
es zeigt sondern liegt in ihm.
| | |
| | | ∫ | | | Gäbe es etwas worauf es
wesentlich zeigt so müßte das als eine Bedingung des
Sinnes vorhanden sein &
gehorte dann mit zum
Symbol.
| | |
| | | ∫ / | | |
„Das Betreten
dieser Brücke ist gefährlich” zeigt nicht auf die Gefahr beim Betreten
des
Betretens |
der Brücke. Und
sofern es auf die Brücke zeigt, gehört diese mit zum
| | |
| | | ∫ | | | Das Mitschwingen der Furcht
mit dem Zeichen.
| | |
| | | | | | Was
heißt die Frage: Ist das dasselbe
‚~’ für
welches die Regel ~~~p =
~p gilt?
| | |
| | | / | | | „Meinst Du das
‚~’ so, daß
ich aus ~p
~~~
p schließen kann?”
| | |
| | | ∫ | | | Wenn für
dieses ‚~’ keine Regel
gilt, so ist das Zeichen bedeutungslos.
| | |
| | | ∫ | | | „Das Wort
‚ist’ in dem Satz ‚der Himmel ist
blau’ ist dasselbe wie das in dem Satz ‚die Rose ist
rot’, aber nicht dasselbe wie das ‚ist’ in
‚2 × 2
ist 4’”. Wenn ich das sagen
kann, so heißt das schon, das ich die Worte nicht nach dem Klang
allein unterscheide, oder dentifiziere. Und
doch muß ich sie wiedererkennen, denn nur ihre
Gemeinsamkeit drückt ja eine Gemeinsamkeit des Sinnes
aus.
| | |
| | | ø | | |
Könnten wir für
‚blau’, ‚rot’,
‚grün’, ‚gelb’ dasselbe Wort
verwenden, wie wir es für ‚ = ’ und
‚ε’ tun, wenn auch mit
der Gefahr der Verwechslung, aber doch der Möglichkeit
zu unterscheiden?
| | |
| | | / | | |
Wie Gesetze nur Interesse gewinnen,
wenn die Neigung besteht sie zu übertreten, [ wenn sie übertreten werden ] so gewinnen
gewisse
gramm. Regeln
erst dann Interesse, wenn die Philosophen sie übertreten
möchten.
| | |
| | | / | | |
Daß das deutsche Wort ‚ist’ & das
englische ‚is’ dasselbe bedeuten
kann man auf zweierlei Art erfahren.
Entweder ich habe die eine Sprache
unabhängig von der andern gelernt & lerne
die andere mit Hilfe (durch Übersetzung) der ersten, lerne
also aus dem Wörterbuche ‚is’
heiße ‚ist’. Oder ich habe beide
Sprachen unabhängig voneinander so
gelernt, wie man in der Kindheit
Muttersprache lernt & komme dann darauf, daß
‚is’ & ‚ist’
einander entsprechen.
| | |
| | | ∫ | | |
Wie weißt Du daß das Wort
‚und’ in diesen beiden Sätzen dasselbe
ist?
| | |
| | | | | | (Mit
In dieser ganzen Diese Fragestellung
scheint etwas nicht in Ordnung zu sein.)
| | |
| | | / | | | Man sagt dem Kind:
„nein, kein Stück Zucker mehr!”
& nimmt es ihm weg. So lernt das Kind die
Bedeutung des Wortes ‚kein’.
Hätte man ihm mit denselben Worten ein Stück Zucker
gereicht, so hätte es gelernt das Wort anders zu
verstehen.
| | |
| | | / | | |
16. Die Regel
beschreibt ihre Anwendung.
| | |
| | | / | | |
Ist es denn willkürlich, welche
Interpretation wir den Worten geben, die uns gesagt
werden? Kommt nicht das Erlebnis der Interpretation mit
dem Erlebnis des Hörens der Zeichen, wenn wir ‚die
Sprache des Anderen verstehen’?
| | |
| | | ∫ | | |
17.
„Das Gebilde & die
Erscheinungen die es
& was es |
hervorruft sich uns doch nur immer selber zeigen, aber nicht von
sich, nach außen, weisen. Und das ist, was das
Symbol zu tun scheint.
| | |
| | | / | | |
Soweit man also das
als einen Vorgang
beschreiben kann, ist es ein Phänomen wie das Sehen des
Zeichens selbst. Die Frage aber ist dann, wo finden wir
ˇnun jenes von sich in den Raum Weisende
[d|w]as das Symbol
zu sein scheint.
| | |
| | | / | | |
Denn alle Zeichen, & was sie mit
sich bringen, scheint uns wesentlich von gleicher Art zu sein.
Es ist, was es ist, ist aber kein Symbol.
| | |
| | | / | | | Als Symbol kann ich die
Dinge nur sehen wenn ich sie von einem andern Standpunkt
betrachte.
| | |
| | | / | | |
Wenn ich z.B. sage
 stellt eine Hand vor, oder: ich verstehe es als Hand, so sage
ich etwas über den Eindruck den das Zeichen
macht. Es ist aber doch keine Hand, noch ist eine
wirkliche Hand im Spiele & wenn ich sage es erinnert mich an
eine Hand, so heißt das, es ruft Vorstellungen,
Empfindungen in mir wach [ … es verursacht in mir
Vorstellungen, Empfindungen, etc ] in denen eine Hand nicht
vorkommt. Heißt das nun also, daß ich diese
Vorstellungen etc. auch anders ohne
Erwahnung der Hand hätte beschreiben
können, und die Anspielung auf die Hand
war?
Aber das ist offenbar dieselbe Frage wie die: wenn ich mir
einen roten Fleck an der Wand vorstelle der nicht da ist, so geschieht
doch etwas, worin nichts wirklich Rotes & jedenfalls kein roter Fleck an dieser Wand eine
Rolle spielt, denn es ist doch keiner da: Kann ich also,
was bei Vorstellen
geschieht nicht beschreiben ohne der Gegenstände
Erwähnung zu tun, die nicht an der Tatsache
beteiligt sind, oder doch nur als ein Teil einer indirekten
Beschreibung des Gegenstandes von dem eigentlich die Rede ist.
– Aber so ist es natürlich nicht.
Und diese Ausführung zeigt nur, worin der falsche
Gedankengangweg
besteht, den zu machen wir versucht sind.
stellt eine Hand vor, oder: ich verstehe es als Hand, so sage
ich etwas über den Eindruck den das Zeichen
macht. Es ist aber doch keine Hand, noch ist eine
wirkliche Hand im Spiele & wenn ich sage es erinnert mich an
eine Hand, so heißt das, es ruft Vorstellungen,
Empfindungen in mir wach [ … es verursacht in mir
Vorstellungen, Empfindungen, etc ] in denen eine Hand nicht
vorkommt. Heißt das nun also, daß ich diese
Vorstellungen etc. auch anders ohne
Erwahnung der Hand hätte beschreiben
können, und die Anspielung auf die Hand
war?
Aber das ist offenbar dieselbe Frage wie die: wenn ich mir
einen roten Fleck an der Wand vorstelle der nicht da ist, so geschieht
doch etwas, worin nichts wirklich Rotes & jedenfalls kein roter Fleck an dieser Wand eine
Rolle spielt, denn es ist doch keiner da: Kann ich also,
was bei Vorstellen
geschieht nicht beschreiben ohne der Gegenstände
Erwähnung zu tun, die nicht an der Tatsache
beteiligt sind, oder doch nur als ein Teil einer indirekten
Beschreibung des Gegenstandes von dem eigentlich die Rede ist.
– Aber so ist es natürlich nicht.
Und diese Ausführung zeigt nur, worin der falsche
Gedankengangweg
besteht, den zu machen wir versucht sind.
| | |
| | | ? / | | | Wenn ich
sage: ich stelle mir einen roten Fleck an dieser Wand vor, so
ist das allerdings die Beschreibung eines Vorgangs, einer
Tatsache, unabhängig von jener andern die der Satz „an
dieser Wand ist ein roter Fleck” beschreibt, aber ich kann
Tatsache nicht anders als durch
die Ausdrücke ‚rot’ &
‚Fleck’ etc., ja nur in dieser
Zusammenstellung beschreiben (in einer Sprache nämlich
in der die Tatsache daß ein roter Fleck an der Wand ist, mit diesen
Worten beschrieben wird.).
| | |
| | | / | | | Und wenn ich mich
darüber wundere, so ich
mich über jeden sprachlichen Ausdruck
wundern.
| | |
| | | / | | |
Hier, glaube ich, sieht man, was
mißverstehen unserer Sprachlogik bedeutet!
| | |
| | | ? / | | |
Wir
sind durch falsche Analogien in die Irre geführt &
können uns nicht aus dieser Verstrickung erretten. Das
ist der morbus
philosophicus.
| | |
| | | ? / | | |
D.h. es ist
eben nicht mehr Grund sich über den Ausdruck
„ich stelle mir einen roten Fleck der
Wand vor” (oder ich wünsche mir etc) zu wundern, als über
den: an der Wand ist ein r. Fl., & über die Ähnlichkeit dieses mit dem
Vorkommen des Wortes ‚rot’
Satz: auf dem Tisch ist
r. Fl. Das Vorkommen des
Wortes ‚rot’ bedeutet eben nicht, daß etwas rot
ist & die Gemeinsamkeit des Wortes
‚rot’ nicht, daß zwei G⌊e⌋genstände
die Farbe gemeinsam haben (es kann das Gegenteil davon bedeuten wie
in dem S[a|ä]tz⌊en⌋ „A ist
rot” & „B ist nicht
rot”.)
| | |
| | | ∫ | | |
Nun könnte ich aber doch sagen, der
Gedanke, die Vorstellung daß etwas der Fall ist, der Wunsch, ist
ein Symbol. ‒ ‒ ‒
| | |
| | | ∫ | | |
Sage ich nicht Etwas
symbolisierte darum, weil ich es verstehe? Das
ist doch gewiß.
| | |
| | | ∫ | | |
Nur durch völliges Absehen
vom Psychologischen können wir zu dem für uns
Wesentlichen kommen.
| | |
| | | ∫ | | |
Ich sehe in den Gängen eines Spitals
das Wort „Silence”
aufgeschrieben. Dieses Wort hat eine Wirkung auf mich
(ich meine das Verstehen) welches das Wort
‚abracadabra’ nicht hat; diese
Wirkung wird nicht dadurch
hervorge[rufen|bracht],
daß ich des Wortes Bedeutung früher gelernt habe (was uns
aber gleichgültig ist). Wenn das chinesische
für ‚Silence’ neben diesem Wort
steht, so bringt es die Wirkung auf mich nicht hervor, aber auf
einen Chinesen, und umgekehrt.
Befolge ich nun den Befehl so geschieht erstens etwas, was durch
den Satz „” ausgedrückt wird, aber darin allein
besteht das Folgen nicht, sondern in diese Tatsache tritt auch der
Befehl selbst ein & noch ein bestimmter
Prozess, den man den der Übertragung
nennen kann, worin dieser besteht ist uns gleichgültig.
‒ ‒ ‒
| | |
| | | ∫ | | |
Ist es nicht so: Im Vorgang des der
Übertragensgung des Zeichens [ des
sich danach Richtens ] hat es den symbolischen Charakter, das was
außer sich weist indem es uns sagt, was wir zu tun haben.
| | |
| | | / | | | Wir
könnten uns den Marsbewohner denken, der auf der Erde
erst nach & nach den Gesichtsausdruck des Menschen als solchen
verstehen lernte & den drohenden erst nach
gewissen Erfahrungen als solchen empfinden lernt. Er
hätte bis dahin diese Gesichtsform wie wir die Form eines Steins
betrachten.
| | |
| | | ∫ | | |
K
Kann ich so nicht sagen: er lernt erst
die befehlende Geste in einer gewissen Satzform verstehen.
| | |
| | | / | | | Wenn
mir jemand etwas sagt & ich verstehe es, so geschieht mir dies
ebenso, wie, daß ich höre was er sagt [ wie, daß ich, was er sagt, höre. ]
| | |
| | | | | | Kann man den Vorgang des
Verständnisses eines Befehls mit dem Vorgang der Befolgung vergleichen, um zu
zeigen, daß diese Befolgung diesem
Verständnis, dieser Auffassung, wirklich entspricht?
und inwiefern sie übereinstimmen?
| | |
| | | / | | | Wie beschreibt die Sprache
(überhaupt) den Vorgang des
Verständnisses des Satzes
‚p’. Kann sie
es anders als durch den Satz, daß ich
‚p’
verstehe? Und kann sie die Befolgung des Befehls
‚q’ anders beschreiben
als indem sie sagt, daß ich
‚q’
befolge? Denn alles was bei diese[m|n]
Vorgängen dadurch noch nicht beschrieben ist, ist
unwesentlich & kann sich so & anders
verhalten.
| | |
| | | ∫ | | |
Einen Satz verstehen heißt ja erst das
sehen, was ihn (überhaupt) zu
einem Satz macht. (Ehe er verstanden ist, ist
er ja ein Muster oder eine Lautreihe.)
| | |
| | | ∫ / | | | Einen
Satz verstehen heißt, ihn als Satz sehen & Befolgung des Befehls kann keine Beschreibung
haben als ihn selbst.
| | |
| | | / | | |
Drury sagte mir heute, er habe überlegt, daß
man sich nicht des Zustandes erinnern könne wo man noch
nicht sprechen konnte es unmöglich sei sich des Zust. zu erinnern vor der
[e|E]rlernung der Sprache. – Man
könnte natürlich Erinnerungsbilder aus Zeit besitzen, aber man kann sich nicht an ein
Fühlen des Mangels der Sprache , da man keinen Begriff der Sprache haben kann, ehe
man spricht & freilich auch nachher nicht, weil es einen
solchen Begriff nicht gibt. Auch kann man sich nicht an das
Bedürfnis nach dem sprachlichen Ausdruck erinnern, denn wo das
vorhanden ist, gibt es schon eine Sprache in der man denkt.
| | |
| | | ∫ | | | Kann man jemandem
…?
Warum
kann man niemandem |
befehlen einen Satz zu
verstehen?
| | |
| | | ∫ | | |
Beim Hören eines Wortes kann ich mir
die Erklärung dieses Worts nicht ins Gedächtnis
zurückrufen; sie kommt, oder sie kommt nicht.
| | |
| | | ∫ | | |
18. Da alles offen
daliegt, ist auch nichts zu erklären. Denn was
etwa nicht offen daliegt interessiert uns nicht.
[ … , denn was etwa verborgen ist
… ]
| | |
| | | ∫ | | |
So die Verneinung, – wenn wir sie
verstehen, – – – –
| | |
| | | / | | |
Die Antwort auf die Frage nach der
Erklärung der Negation ist wirklich: verstehst Du sie
denn nicht? Nun, wenn Du sie nicht verstehst, was
gibt ⌊es⌋ da noch zu erklären
für eine
Erklärung |
, was hat
hat eine Erklärung da noch zu tun?
| | |
| | | / | | | Wir unterscheiden
aber doch aber Sprache von dem was nicht
Sprache ist. Wir sehen Striche & sagen, sie
bedeuten wir verstehen sie, & andere, &
sagen, sie bedeuten nichts (oder uns nichts).
Damit ist doch eine allgemeine Erfahrung charakterisiert, die
wir nennen könnten: „etwas als Sprache
verstehen” – ganz abgesehen davon was wir aus
dem gegebenen Gebilde herauslesen.
| | |
| | | ∫ | | |
(Blumenorakel) Abzählen der Knöpfe.
In diesem Fällen setzen wir auch eine
Regel fest & richten uns dann nach ihr. Wir lesen
etwas von unseren Knöpfen ab.
| | |
| | | / | | | Wir unterscheiden eine
Schrift von dem was Schrift ist.
Was heißt es, etwas als Schrift sehen? Heißt es
mich danach richten?
| | |
| | | / | | |
Wenn ich mich nun danach richte –
wähle ich die Art wie ich mich danach richte? Nein,
denn sonst würde ich mich wenigstens in dieser Beziehung nicht
nach dem Zeichen Richten.
Wie aber wenn ich doch die Art der Interpretation
wähle? (Würfeln)
| | |
| | | / | | | Angenommen ich lasse mich
(wie ich oben beschrieben habe) von den Bäumen auf meinem
Spazierweg leiten: Das setzt doch voraus, daß ich eine
Regel festsetze & mich nach der Festsetzung richte, d.h. es hätte keinen Sinn zu sagen,
ich richte mich nach den Bäumen, wenn ich die Art der
Interpretation erst für jeden einzelnen Fall bestimmen
wollte d.h. in diesem Fall wäre es eben
keine Interpretation sondern eine ganz
überflüssige Zuordnung. Es kann nicht
heißen: Hier ist ein Baum, also will ich hier einmal
links gehen, sondern: Hier ist ein Baum also muß ich
hier etc. …. Das
‚also’ im ersten hat keinen Sinn & es muß hier einfach
‚und’ heißen. Bei der Interpretation
aber hat es Sinn.
Und das
‚also’ ist natürlich kein kausales,
& wir können nicht fragen „bist Du sicher, daß Du deswegen
links gehen
mußt?”.?•
| | |
| | | | | | Ich könnte nun auch sagen
„also muß ich nach meiner Festsetzung links
gehen” Aber hier ist das
merkwürdige, daß ich nun nicht nocheinmal sage:
„und diese Festsetzung ist nach jener anderen
(Festsetzung) so zu deuten”,
& es wäre ja auch unsinnig, denn dieser Regress
diese
Regression |
ist endlos.
| | |
| | | | | | Das was ich in
der ⇒letzten •
Bemerkung geschrieben habe, war aber doch
falsch. Wahr ist es, daß zur Interpretation das
also gehört & nicht das und.
Aber ich könnte etwa sagen daß es nicht nötig war eine
Festsetzung zu treffen d.h. die allgemeine Regel
vorher auszusprechen (das ist Geschichte), wohl aber einer
Festsetzung zu folgen. Und ich könnte sagen, es ist
nicht genug einer Regel folgen, denn das geschieht, was
immer ich tue, sondern ich muß einer Festsetzung folgen, das ist
ein anderer Prozess.
| | |
| | | | | | Aber ich will sagen, dieser
Prozess kann nur äußerlich verschieden
sein von einem Handeln, das sich nicht nach einer Festsetzung
richtet. So verschieden wie auch zwei Arten des
äußerlichen Verhaltens
Benehmens [ … äußeren Verhaltens ] |
sein
können (oder zwei Zeichengruppen an der
Tafel)
| | |
| | | ∫ | | |
„Ich habe mich dabei nach dieser
Regel gerichtet” beschreibt einen bestimmten
(psychischen, physikalischen) Vorgang. Einen
andern als der Satz: Die Resultate folgen dieser
Regel – – – –
| | |
| | | / | | | Der
Festsetzung Folgen muß ein Vorgang sein, aus dem man den
Ausdruck der Regel ablesen kann. Es besteht also nicht
darin, daß mehrere Vorgänge [ eine Reihe
von Vorgängen ] , Intentionen, einer Regel folgen, denn
dann wäre diese Regel wieder ein Erfahrungssatz
& natürlich nicht eindeutig durch die
Vorgänge [ Tatsachen ]
bestimmt.
Und ich muß die Regel
eindeutig aus dem Vorgang ablesen können.
Sonst könnte sie ja auch in der Beschreibung des Vorgangs
nicht enthalten sein müssen.
| | |
| | | / | | | Wer die allgemeine Regel
die er erkennt nun herausschreibt, schreibt mehr
auf als er sieht.
Behaviouristische Deutung:
Er schreibt die
Quadrate der oberen Zahlen
7,
49,
| 5,
24,
| 3,
18,
| 4
16,
|
Er schreibt
nicht die Quadrate …
Er die Quadrate an Er will
die Quadrate anschreiben & tut es
Er
will die Q. nicht anschreiben tut es
aber.
etc.
| | |
| | | / | | | Der
Prozess des Lernens hat natürlich etwas
mit der Anwendung der Sprache gemein. Das was der
Ausdruck der allgemeinen Regel mit ihrer Anwendung gemein
hat.
| | |
| | | ? / | | |
Der Der Befehl ist die Beschreibung seiner
Ausführung.
| | |
| | | / | | |
Haben wir hier nicht das Wesen des Motivs
im Gegensatz zur Ursache? Offenbar
ja Der Befehl wird, wenn
ich ihn befolge zum Motiv meiner Handlungsweise.
| | |
| | | / | | | Und das Motiv ist
nicht hypothetisch. In dem Motiv kann ich micht
nicht irren es ist in meiner Handlung enthalten, aber nicht so ihre
Ursache.
| | |
| | | / | | |
(Ogden
& Richards
& Russels Theorie
der Bedeutung beruht also auf einer
Verwechslung, oder Gleichsetzung, von Motiv und
Ursache.)
| | |
| | | | | |
19. Zu dem früheren Satz: Der
Baum muß die Entscheidung treffen.
| | |
| | | / | | | Das Befolgen des Befehls
liegt darin, daß ich etwas tue ‒ ‒
[k|K]ann ich aber auch sagen, „daß ich
das tue, was er befiehlt”? Gibt es ein Kriterium
dafür, daß das die Handlung ist, die ihn befolgt?
| | |
| | | / | | |
Das muß Es gibt kein Kriterium
dafür daß das die Handlung ist, die den Befehl
befolgt.
| | |
| | | / | | |
Das muß natürlich heißen
„wir können von so einem Kriterium nicht
reden”.
| | |
| | | ∫ | | |
Das hängt unmittelbar damit
zusammen, daß wir eine Handlung nicht vorausnehmen
können. Was wieder nur soviel heißt, als daß es keinen Sinn hat zu
sagen, die Handlung zu eine[m|r] bestimmten Zeit finde zu
einer gewissen Zeit statt.
| | |
| | | / ∫ | | | Was wir wollen ist
doch wohl, die Grammatik des Ausdrucks „der Befehl wird
befolgt” klarzulegen. [ auseinanderzulegen ] 6
| | |
| | | / ∫ | | |
„Ja woher weiß ich aber dann, daß ich den Befehl
befolgt habe?” ‒ ‒ ‒7
| | |
| | | / ∫ | | |
(Ich
kann den centralen grammatischen Fehler nicht
finden auf dem alle diese Probleme
b⌊e⌋ruhen)8
| | |
| | | / ∫ | | |
Es ist das
natürlich die selbe Frage wie die: Woher weiß ich,
daß dieser Satz diese Tatsache beschreibt?9
| | |
| | | / ∫ | | |
Und ich möchte immer antworten: „weil ich ihn
ja von dieser Tatsache heruntergelesen habe”.
Und: „ich muß doch wissen, wie ich zu ihm
gekommen bin”.
| | |
| | | / | | |
Wenn ich ein Kriterium angeben
könnte, so muß ich es mit der Sprache angeben &
dann müßte ich es nach dem sprachlichen Ausdruck erkennen
können; aber zu diesem Erkennen brauchte ich ja selbst wieder das
Kriterium.
| | |
| | | / | | |
Wenn ich Worte wählen kann, daß
sie der Tatsache – in irgend einem
Sinne – passen, dann muß ich also schon vorher einen
(allgemeinen)
[b|B]egriff dieses Passens gehabt haben.
Und nun fängt das Problem von neuem an, denn wie weiß
ich, daß dieser
Sachverhalt dem Begriffe vom Passen entspricht.
| | |
| | | ∫ | | | Aber warum
beschreibe ich dann die Tatsache gerade so? Was
machte Dich diese Worte sagen?
| | |
| | | / | | | Und wenn ich nun sagen
würde: „alles was geschieht, ist eben, daß ich
auf diese Gegenstände sehe & dann diese Worte
gebrauche”, ⋎ wäre die Antwort:
„also besteht das Beschreiben in weiter nichts & ist
es immer eine Beschreibung wenn einer
…?”. Und darauf müßte ich
sagen: „Nein. Nur kann ich den Vorgang
nicht anders, oder doch nicht mit einer anderen Multiplizität
beschreiben, als, indem ich sage: ‚ich
beschreibe was ich sehe’ & darum ist
keine Erklärung mehr möglich, weil mein Satz bereits die
Multiplizität hat.
| | |
| | | / | | |
Ich könnte auch so fragen:
Warum verlangst Du Erklärungen? Wenn diese
gegeben ⌊sein⌋ ,
wirst Du ja doch wieder vor einem Ende stehen. Sie
können Dich nicht weiter führen als Du jetzt bist.
| | |
| | | ∫ | | | Denn wenn ich
frage: „was bedeutet es denn ‚gemäß
einer Regel übersetzen’?” so erwarte ich
doch (wohl) eine Antwort: es
bedeutet das & das; dann kann ich doch aber weiter fragen
„& was bedeutet das?”. u.s.w.
| | |
| | | / | | |
Wir müssen am Schluß die
Sprache ohne Erklärung
ben[u|ü]tzen.
| | |
| | | ∫ | | |
Erklären des Nähens oder des Rauchens im Gegensatz
zum
Erklär[ung|en]
des Übersetzens.
Dort gibt die
Erklärung immer eine Beschreibung die nicht die des
unmittelbar Wahrgenommenen ist.
| | |
| | | / | | |
20. Der Mensch hatte
vom Nähen oder Rauchen einen Begriff ehe man's ihm
erklärt hatte. Und nach der Erklärung
weiß er mehr davon als vorher. Die
Erklärung des Denkens die wir fordern soll uns aber
nicht mehr darüber sagen als was wir wissen.
| | |
| | | / | | | Deshalb kann
der nach der Erklärung des Rauchens fragen.
Und die Antwort kann nicht die Beschreibung dessen sein was er
unter „Rauchen” versteht, sondern die Beschreibung
eines andern Vorgangs.
| | |
| | | / | | |
(Ich nie
sagen: „aus diesen Gründen muß es
sich so verhalten”. Denn was nicht offenbar ist,
ist für mich nicht vorhanden.) | | |
| | | | | |
21. Ich kann nur die Schlüssel reichen,
aufsperren muß jeder selbst.
| | |
| | | ∫ | | | Die Regel
„du mußt quadrieren” zu sagen (zu
verstehen) ist etwas anderes als die 5 zu quadrieren.
| | |
| | | ∫ | | | „Wenn
immer wir etwas sagen, wenn es auch gegen die gebräuchliche
Grammatik verstößt, meinen wir etwas damit”; was
heißt das?
| | |
| | | ∫ | | |
Wenn es etwas heißt, muß es
die Beschreibung eines Phänomens sein. Aber
welches Phänomens?
| | |
| | | ∫ | | |
Dieses Phanomen
ist offenbar das des Denkens. –
| | |
| | | / | | | Das Triviale, was ich zu
sagen habe ist, daß auf den Satz „ich sage das
nicht nur, ich meine etwas damit” & die Frage
„was?”, ein weiterer Satz, in irgend welchen
Zeichen zur Antwort steht.
| | |
| | | / | | | (Ich kann nur die
Schlüssel reichen aufsperren muß jeder selbst.)
| | |
| | | ∫ | | | Ich kann aber
doch auch fragen: Wie sieht ein Sonnenuntergang
aus? auch wenn ich von allem Hypothetischen absehe.
| | |
| | | / | | | Und so kann
ich natürlich auch das Denken beschreiben, denn ich kann ja auch
das Reden beschreiben.
| | |
| | | / | | |
„Ich sage das nicht nur, ich
meine auch etwas damit” – Wenn man
sich überlegt was dabei in uns vorgeht, wenn wir Worte
meinen (& nicht nur sagen) so ist es uns, als
wäre dann etwas mit diesen Worten gekuppelt, während sie
sonst ◇ leer liefen. – Als ob sie
gleichsam in uns eingriffen.
| | |
| | | / | | |
Niemand kann uns Gesichtsraum näher kennen lehren. Aber
wir können seine sprachliche Darstellung übersehen
lernen.
| | |
| | | / | | |
Wenn ich [R|r]echt habe,
so müssen sich philosophische Probleme wirklich restlos
lösen lassen, im
Gegensatz zu allen andern.
| | |
| | | / | | | Wenn ich sage:
Hier sind wir an der Grenze der Sprache, so das immer, als wäre hier eine Resignation
nötig, während im Gegenteil volle Befriedigung
eintritt da keine Frage übrigbleibt.
| | |
| | | / | | | Die Probleme
werden im eigentlichen Sinne aufgelöst – wie
ein Stück
Zucker
eine Substanz |
im Wasser.
| | |
| | | ∫ | | |
Alles was, [ von logischem Interesse ]
von Interesse |
, wir liefern
können, ist die Beschreibung der Sprache. – Dazu
gehört alles, was wir zur Erklärung ihrer Anwendung
sagen können.
| | |
| | | ∫ | | |
Die ‚Erklärung des
Denkens’ müßte dem der nicht weiß, was
Denken ist, es erklären können.
Sie müßte also auch den dazu anleiten
können, der es früher nicht getan hat [ … es
erklären können. Ihn dazu anleiten
können. ] .
Und das alles mittels
Gedankens.
| | |
| | | / | | |
jede Tätigkeit (schreiben, sprechen, nähen,
rauchen) beschreibbar, lehrbar, ist, ist Denken keine
Tätigkeit. So wenig, wie
sich-Ärgern, das auch so wenig
lehrbar ist. (Meine Bemerkung über
‚kein Subject im
Denken’. Keine Tätigkeit ohne
Täter.)
| | |
| | | / | | |
Das Interesse an dem Psychologischen des
Denkens ist dadurch für uns aufgehoben, daß wir uns nur
für die Beziehung des Denkens zu sich selbst interessieren
& das Psychologische dadurch wegfällt, sich
kürzt.
| | |
| | | ∫ | | | Es ist der
Sprache wesentlich, daß Wort in
verschiedenen Satzen vorkommt,
verschiedene Sätze dieses Wort gemein haben. Und
daß der Gleichlaut der Worte, wenn verschiedene
Gruppen grammatischer Regeln
grammatische Regeln |
von
ihnen gelten auch durch verschieden lautende ersetzt werden
, weil dann der Laut eine
bedeutungslose
unbedeutende |
, äußerliche,
Ähnlichkeit ist.
| | |
| | | | | |
Wenn ich nun aber das Wort „ist”
betrachte: Wie kann ich hier zwei verschiedene
Anwendungsarten unterscheiden, wenn ich nur auf die
grammatischen Regeln ?
Denn diese erlauben ˇja eben die
[v|V]erwendung des Wortes im
Zusammenhang „die Rose ist rot” &
„2 × 2 ist
4”. Aus diesen Regeln sehe ich
nicht, daß es sich um zwei daß wir hier zwei
verschiedene Wörter handelt haben. – Ich ersehe es
aber z.B. wenn ich
ver[stehe|suche] in beiden Sätzen statt ‚ist’
‚ist gleich’
(oder auch: ‚hat die
Eigenschaft’) Aber nur wieder, weil
ich für den Ausdruck „ist gleich” die Regel
kenne, daß er in „die Rose … rot”
nicht eingesetzt werden darf. [ nicht
darf.
| | |
| | | | | | Überhaupt: wovon gelten die
gramm. Regeln, wenn sie vom Wort
‚ist’ gelten? Vom Laut, den ich dann
& da ausspreche [ hervorgebracht
habe ] ? Von dem was allen
‚ist’-Lauten gemeinsam ist?
Sie gelten von ‚ist’, wenn es in
diesem Sinne gebraucht wird[,|.] –
„[w|W]enn du es
anwendest, so
gebrauchst Du es eben nicht in diesem
Sinne”.
| | |
| | | / | | |
Die Frage ist : ist alles was ich hier treibe nicht
Mythologie? Dichte ich nicht zu dem Offenbare[m|n] dazu?
Wenn ich nämlich von dem Vorgang rede der beim Verstehen
(verständnisvollen Aussprechen oder Hören) des
Satzes vor sich geht.
| | |
| | | / | | |
D.h. könnte ich nicht die Sprache als
soziale Einrichtung betrachten, die gewissen Regeln unterliegt, weil
sie sonst nicht wirksam wäre [ wirken
würde ] . Aber hier liegt es: dieses
kann ich nicht sagen; eine
Rechtfertigung der Regeln kann ich, auch so, nicht geben.
Ich könnte sie nur als ein Spiel, das die Menschen spielen,
beschreiben.
| | |
| | | / | | |
Wenn ich mich weigere ein Wort,
z.B. das Wort ‚ist gleich’ in
zwei Zusammenhängen zu gebrauchen, so ist der Grund
das, was wir mit den Worten beschreiben „das Wort habe
in den beiden Fällen verschiedene Bedeutung [ das Wort werde
in diesen Fällen in verschiedenem Sinn
gebraucht ]
| | |
| | | / | | | Kann ich nun aber das was
die gramm. Regeln von einem Worte
sagen, auch anders beschreiben, nämlich durch die Beschreibung
des Vorgangs der beim Verstehen des Wortes stattfindet?
| | |
| | | / | | | Wenn also
die Grammatik – z.B. – die Geometrie
der Verneinung ist, kann ich sie durch eine Beschreibung dessen
ersetzen, was bei der Verwendung sozusagen hinter dem Wort
‚nicht’ steht?
| | |
| | | / | | | Aber so eine Beschreibung
wäre doch – wie gesagt – ein Ersatz ‚nicht’, etwa wie
und könnte die
Grammatik nicht ersetzen.
(﹖)
| | |
| | | / | | |
In meiner Darstellung schienen
doch die gramm. Regeln die
Auseinanderlegung dessen was ich im Gebrauch des Wortes auf einmal
erlebe. Sozusagen (nur)
Folgen Äußerungen der Eigenschaften, die ich beim Verstehen
auf einmal erlebe. Das muß natürlich ein
Unsinn sein.
| | |
| | | / | | |
Man würde ja geradezu sagen:
Verneinung hat die Eigenschaft, daß sie
verdoppelt eine Bejahung ergibt. (Etwa
wie: Eisen hat die Eigenschaft, mit Schwefelsäure
Eisensulphat zu geben) während die
gramm. Regeln die Verneinung nicht
näher beschreib[en|t] sondern
constituiert.
| | |
| | | / | | | Daß wir dieses Wort
dieser Regel gemäß gebrauchen, das dafür einsetzen
etc., damit documentieren wir,
wie wir es meinen.
| | |
| | | / | | |
Das Wort ‚nicht’ in der gramm. Regel hat keine Bedeutung,
sonst könnte das nicht von ihm ausgesagt
werden.
| | |
| | | / | | |
Die Negation hat keine andere
Eigenschaft, als etwa die in gewissen Sätzen die Wahrheit
zu ergeben.
Und ebenso hat ein Kreis die
Eigenschaft da [&|o]der dort zu stehen, diese Farbe
zu haben, von einer Geraden tatsächlich geschnitten zu
werden; aber nicht, was ihm die Geometrie zuzuschreiben
scheint. (Nämlich diese Eigenschaften haben
zu können.)
| | |
| | | / | | |
Was heißt es:
„Dieses Papier ist nicht schwarz &
‚nicht’ ist hier
gebraucht, daß eine dreifache Verneinung eine Verneinung
ergibt”? Wie hat sich denn das im Gebrauch
geäußert?
| | |
| | | / | | |
Oder: „Dieses Papier
ist nicht schwarz & zwei von diesen Verneinungen geben eine
Bejahung”. Kann ich das sagen?
| | |
| | | / | | | Oder:
„Dieses Buch ist rot & die Rose ist rot
& die beiden Wörter ‚rot’ haben die
gleiche Bedeutung” (Dieser Satz ist
von gleicher Art, wie die oberen Sätze)
Was ist denn das für ein Satz? ein
grammatischer? Sagt er etwas über das Buch und die
Rose?
| | |
| | | / | | |
Ist der Zusatz zum Verständnis des
ersten Satzes nicht nötig, so ist er Unsinn, & wenn
nötig, dann war das erste noch kein Satz; & dasselbe gilt
in den oberen Fällen.
| | |
| | | / | | |
„Daß 3 Verneinungen wieder
eine Verneinung ergeben muß doch schon in der einen
Verneinung die ich jetzt gebrauche
liegen” Aber denke
deute ich hier nicht schon wieder?
(d.h. bin ich nicht im Begriffe eine
Mythologie zu erfinden?)
| | |
| | | / | | |
Aber sind die
gramm. Regeln nicht
Regeln des Übergangs von
einem Satz zum andern?
| | |
| | | / | | |
Inwiefern kann man sagen:
„diese Regel gilt von dieser
Verneinung”?
| | |
| | | / | | |
Heißt es etwas, zu sagen, daß drei
solche Verneinungen eine Verneinung ergeben. (Das erinnert
immer an „drei solche Pferde können diesen Wagen
fortbewegen”) Aber, wie
gesagt, in jenem Logischen Satz ist gar nicht von
der Verneinung [z|d]ie Rede (von der Verneinung handeln
nur Sätze wie: es regnet nicht) sondern nur vom Wort
‚nicht’, & es ist eine Regel über die
Ersetzung eines Zeichens durch ein anderes.
| | |
| | | / | | | Aber können wir die
Berechtigung dieser Regel nicht einsehen, wenn wir die
Verneinung verstehen? Ist sie nicht eine Folge aus
dem Wesen der Verneinung? Sie ist nicht eine Folge aber
ein Ausdruck dieses Wesens.
| | |
| | | / | | |
Was wir sehen, wenn wir einsehen, daß
eine doppelte Verneinung
etc., muß von der Art
dessen sein, was wir im Zeichen wahrnehmen.
| | |
| | | / | | | Wenn ˇich
ein dreidimensionales Gebilde, etwa einen Würfel, sehe so sehe
ich in gewissem Sinne die Möglichkeit, Würfel
gleicher Größe in drei Richtungen an diesen Würfel
anzubauen. Die Geometrie sagt mir dann, daß ich dies
könne. Sehe ich ein Quadrat, so sehe ich
diese Möglichkeit nicht. etc.
| | |
| | | / | | | (Die
perspectivische Zeichnung eines
Würfels & solcher Würfelgruppen ist ein
herrliches Exempel, wie man den dreidimensionalen Raum
in die Ebene abbilden kann)
| | |
| | | / | | | Die
Geometrie spricht aber so wenig von Würfeln, wie die Logik von der
Verneinung (Man möchte hier vielleicht
einwenden, daß die Geometrie vom Begriff des Würfels &
die Logik vom Begriff der Negation handelt. Aber diese
Begriffe gibt es nicht.)
| | |
| | | / | | |
Man kann einen Würfel – ich
meine das Wesentliche des Würfels – nicht
beschreiben. Aber kann ich denn nicht beschreiben,
wie man z.B. eine Kiste macht? und ist
damit nicht eine Beschreibung Würfels
? Das
Wesentliche am Würfel ist damit nicht beschrieben, das steckt
vielmehr in der Möglichkeit dieser Beschreibung
d.h. darin, daß sie eine Beschreibung
ist; nicht darin daß sie zutrifft.
| | |
| | | / | | | Nun kann ich doch
aber sagen: „Ich sehe die Figur
 3-dimensional”. Aber
dieser Satz entspricht der Beschreibung einer Kiste. Er
beschreibt einen bestimmten Würfel nicht die
Würfelform. Freilich kann ich das Wort
„Würfelform” definieren.
D.h. Zeichen geben, durch die es ersetzt
werden .
3-dimensional”. Aber
dieser Satz entspricht der Beschreibung einer Kiste. Er
beschreibt einen bestimmten Würfel nicht die
Würfelform. Freilich kann ich das Wort
„Würfelform” definieren.
D.h. Zeichen geben, durch die es ersetzt
werden .
| | |
| | | / | | | Man kann eine
geometrische Figur nicht beschreiben. Auch die Gleichung
beschreibt sie nicht, sondern vertritt sie durch die Regeln die von
ihr gelten.
| | |
| | | / | | |
Und haben wir hier nicht das Wort Figur so
, wie in unseren Betrachtungen so
oft das Wort „Gedanke” oder
„Symbol”? Die Art der Anwendung dieses
Wortes von welcher ich sagte, es bedeute dann kein
Phänomen, sondern sei quasi ein unvollständiges & entspreche eben einer
Funktion.
| | |
| | | / | | |
Man kann ˇauch nicht sagen, die
Würfelform habe die Eigenschaft, lauter gleiche Seiten zu
besitzen. Wohl aber hat ein Holzklotz diese
Eigenschaft. (Noch hat „die Eins die
Eigenschaft zu sich selbst addiert Zwei zu
ergeben”.)
| | |
| | | / | | |
Ich sagte doch: Es schien als
wären die gramm. Regeln die
Folgen-in-der-Zeit dessen, was wir in einem Augenblick
wahrnehmen, wenn wir eine Verneinung verstehen.
Und als gebe es also zwei Darstellungen des Wesens der
Verneinung: Den Akt (etwa den seelischen Akt) der
Verneinung selbst, & seine Spiegelung in dem System der
Grammatik.
| | |
| | | / | | |
Man könnte sagen
ist versucht zu sagen |
: die Gestalt eines Würfels wird
doch sowohl durch die Grammatik des Wortes
„Würfel”, als auch durch einen Würfel
 dargestellt.
dargestellt.
| | |
| | | / | | |
In
„~p ∙ (~~p
= p)” kann der zweite Teil nur eine
Spielregel sein.
| | |
| | | / | | |
Es hat den Anschein, als könnte man
aus der Bedeutung der Negation schließen, daß
~~p
p heißt.
| | |
| | | / | | |
23.
Als würden aus der Natur der Negation die Regeln über das
Negationszeichen folgen.
So daß,
in gewissem Sinne, die Negation zuerst vorhanden & dann die Regeln der Grammatik.
| | |
| | | / | | |
Es ist also, als hätte das Wesen der
Negation einen zweifachen Ausdruck in der Sprache:
Dasjenige was ich sehe, wenn ich die Negation verstehe,
& die Folgen dieses Wesens in der Grammatik.
Anderseits ist es klar, daß die Regeln, wenn sie
aus dem Wesen der Negation hervorgehen, nicht
ˇwie aus einer Regel, einem Satz, folgen.
Und täten sie es, so wäre eben dieser Satz die
eigentliche [S|R]egel auf die es uns ankäme.
| | |
| | | / | | | Ich will
also sagen: die Regeln folgen nicht aus dem Wesen der
Negation, sondern sie drücken es aus.
| | |
| | | / | | | Ich kann
die Regeln
über die Negation von ihr ablesen. Aber das scheint
eben zu , daß sie schon
irgendwoanders,
nämlich in der Negation, aufgeschrieben
stehen. Das, wovon ich sie ablese muß die gleiche
Mannigfaltigkeit haben, wie sie selbst.)
| | |
| | | / | | | Ist das nicht so,
wie ich aus einer Figur geometrische Sätze ablesen
kann?
| | |
| | | / | | |
Statt der Betrachtung der Negation,
könnte ich auch die eines Pfeiles setzen
→
& z.B. sagen: wenn ich ihn zweimal
um 180˚ drehe, zeigt er
wieder, wohin er jetzt zeigt; welcher Satz dem
~~p = p
entspricht. Wie ist es nun hier mit der Darstellung
des Wesens dieses Pfe⌊i⌋ls durch die Sprache? Jener
Satz muß doch unmittelbar von diesem Wesen sein & es also darstellen.
| | |
| | | ? / | | |
Oder nehmen wir den Fall eines
Quadrats & eines Rechtecks & die Sätze, daß
das Quadrat durch eine Vierteldrehung mit sich selbst zur Deckung
gebracht werden kann; das Rechteck aber erst durch eine halbe
Drehung.
Ich habe sie offenbar von dem
Quadrat & dem Rechteck abgelesen. Aber was
sind das überhaupt für Sätze? Wenn sie von
bestimmten quadratischen oder rechteckigen Stücken
handelten, wären es Hypothesen. Hier aber sind es
geometrische Sätze.
| | |
| | | ∫ | | |
Es ist ganz klar, daß dieses
S Drehen dem Ausschließen eines Teils einer
Fläche  analog ist,
& das wieder der Verneinung, & die angeführten
Sätze den analog ist,
& das wieder der Verneinung, & die angeführten
Sätze den Sätzen von
der
Regeln über die |
Verneinung.
| | |
| | | / ∫ | | |
Wie weiß ich daß ein Wort in diesen
Fallen in verschiedenen Bedeutungen
angewendet ist?
| | |
| | | ∫ | | |
Wie weiß ich, daß ein Wort hier
Eigenschaftswort, dort Hauptwort ist?
| | |
| | | ∫ | | | Dadurch, daß kein
Gemeinsames verloren geht, wenn ich verschieden Worte statt der gleichlautenden setze.
| | |
| | | ∫ | | | Wie weiß
ich, daß ich diese beiden Wörter durch eines ersetzen kann,
weil sie nämlich das gleiche bedeuten?
D.h., wie weiß ich, daß sie das gleiche
bedeuten?
| | |
| | | ∫ | | |
Könnte die bloße äußere Erfahrung, die Menschen
[R|r]eden zu hören, (wenn es für das Wort
‚ist’ keine Ersatzwörter gäbe)
dazu bringen, verschiedene Bedeutungen, verschiedene
Wörter
‚ist’
Arten des Wortes |
, zu unterscheiden?
Offenbar nicht, denn jeder Unterschied des Benehmens bildete schon
ein anderes Zeichen.
| | |
| | | / | | |
24. Zu sagen daß
eine [v|V]ierteldrehung ein Quadrat mit sich selbst zur
Dekkung bringt, heißt doch offenbar
nichts andres als: Das Quadrat ist um zwei
zu einander senkrechte Achsten
symˇmetrisch, & das wieder, daß es Sinn hat von den
zwei senkrechten Achsen zu Reden ob sie vorhanden
sind oder nicht. Das ist ein Satz der
Grammatik.
| | |
| | | ∫ | | |
Die Schwierigkeit ist wieder, daß es
scheint, als wäre in einem Satz, der etwa das Wort
‚Quadrat’ enthält schon der Schatten eines
anderen Satzes mit diesem Worte enthalten –
Nämlich eben die Möglichkeit
jene[s|n] anderen Satzes zu bilden, die ja, wie ich
sagte, im Sinn des Wortes Quadrat liegt.
| | |
| | | / | | | Und doch kann man
eben nur sagen, der andere Satz ist nicht mit diesem ausgesprochen,
auch nicht schattenhaft. (Und wird vielleicht nie
ausgesprochen werden.)
| | |
| | | | | |
Aber er ist doch schon ausgesprochen, wenn ich sage
„er kann ausgesprochen werden”.
| | |
| | | / ∫ | | |
Denken wir daran, daß man ja die Regeln der Grammatik nie
auszusprechen brauchte & die Sprache dennoch gebrauchen
kann. (Die menschliche Sprache bestand gewiß ehe jemand
gramm. Regeln aussprach &
ein Kind lernt die Sprache sprechen die Sprache ohne
solche, & die wieder haben keine Grammatik.
Das heißt natürlich nicht daß ihre Sprache keinen
gramm. Regeln folgt, sie sprechen
diese Regeln nur nicht aus.)
| | |
| | | ∫ | | |
Die Grammatik ist eine nachträgliche
Beschreibung der Sprache.
| | |
| | | / ? ∫ | | |
Die Grammatik sagt
z.B.: so wird das Wort
‚Quadrat’ gebraucht. Aber das muß doch
schon in dem
Gebrauch dieses Wortes liegen!
Was heißt
aber: Es muß darin liegen?
Heißt es etwas
anderes, als
daß ich auch nach diesem einen Gebrauch die Regeln für
das Wort muß angeben können?
(﹖)10
| | |
| | | | | |
Daß ich sagen kann: „Nein so habe
ich es nicht gebraucht, nicht in dem Sinn,
in⌊/⌋dem ich sagen könnte
– – – –, sondern in dem Sinn – – – – –.
| | |
| | | / | | | Mein Problem könnte
man auch so aussprechen: „Wie
kann sich jene Erklärung (die ich einmal gelernt
habe) auf dieses Wort (das ich eben
aus[p|s]prach) zei
beziehen?”
| | |
| | | ∫ | | |
Und meine Meinung ist die, daß die
gramm. Regeln über die
Negation, z.B. ~~p = p,
zur Erklärung der Bedeutung von
‚~’ gebraucht werden könnten: daß
die Regeln eine solche Erklärung wären; & daß
daher ihre Wirkung gerade das wäre, was man das Verständnis
des Negationszeichens nennt. Und das wäre die
Beziehung dieses Verständnisses zu den gramm. Regeln.
(wobei ‚Wirkung’ nicht kausal zu verstehen
ist.)
| | |
| | | / | | |
Daß ein Wort nur im Satz Bedeutung hat,
heißt nichts, als daß es seine Funktion nur im Satz hat.
Einzeln kann es wohl eine Vorstellung erwecken, aber diese
ist nicht seine Bedeutung, noch ist es die Funktion eines Wortes eine
bestimmte Vorstellung aufzurufen.
| | |
| | | ∫ | | | Kein Satz der Sprache kann
uns als Überraschung kommen (wohl aber eine
Wahrheit) Das ist es doch, was ich meine,
wenn ich sage: Wir können nach dem einen Gebrauch des
Wortes die Regeln für das Wort angegeben. Denn das
heißt ja seinen Gebrauch in Sätzen zu
beschreiben. D.h. eine allgemeine
Beschreibung aller möglichenr Sätze zu
geben.
| | |
| | | / | | |
Es könnte nun werden
daß ich die Bedeutung, z.B., der Worte
‚blau’ & ‚rot’ vertauschen
könnte & dadurch zwar Sätze die früher wahr
jetzt falsch u.u. würden, aber kein Satz
der früher Sinn hatte, jetzt unsinnig würde
u. u.. Das ist wahr[,|.]
es Es ist aber
dabei nicht bedacht, daß die auch Sätze wie
„das hat diese Farbe” zu unserer Sprache gehören &
die Grammatik mir dann sagen muß daß dieser Satz soviel heißt
wie „das ist rot”.
| | |
| | | ? / | | |
Es frägt sich einfach:
Was ist das für ein Satz „das Wort
‚ist’ in ‚die Rose ist rot’ ist
dasselbe wie in ‚das Buch ist rot’, aber nicht
dasselbe wie in
‚2 × 2
ist 4’”? Man kann nicht antworten, es
heiße, verschiedene Regeln gelten von den beiden Wörtern,
denn damit geht man im Zirkel. Wohl aber heißt es, das
Wort ist in seiner verschiedenen Verbindung durch zwei
Zeichen ersetzbar, die nicht für einander einzusetzen
sind. Ersetze ich dagegen das Wort in den beiden
ersten Sätzen durch zwei verschiedene Wörter, so kann
ich sie füreinander einsetzen.
| | |
| | | / | | | Nun könnte ich wieder
fragen: sind ist diese Regeln
Regel nur
eine Folge des Ersten: daß im einen Fall
die beiden Wörter ‚ist’ die gleiche Bedeutung
haben, im andern Fall nicht? Oder ist es so, daß diese
Regel eben der sprachliche Ausdruck dafür ist, daß die
Wörter das gleiche bedeuten?
| | |
| | | / | | |
Ich will es damit vergleichen, daß das Wort
‚ist’ einen anderen Wortkörper
hinter sich hat. Daß es beidemale die gleiche Fläche ist, die einem andern Körper
angehört, wie wenn ich ein Dreieck im Vordergrund
sehe das das einemal die Endfläche
eines Prismas das andre mal eines Tetraeders ist.
| | |
| | | / | | | Oder denken
wir uns diesen Fall: Wir hätten Glaswürfel deren
eine rot
gefärbt wäre. Wenn wir sie
aneinanderreihen, so wird im Raum nur eine ganz bestimmte
Anordnung roter Quadrate entstehen können, bedingt durch
die Würfelform der Körper. Ich könnte
nun die Regel nach der hier rote Quadrate angeordnet sein
können auch ohne Erwähnung der Würfel
angeben, aber in ihr wäre doch bereits das Wesen
de[s|r]
Würfe[ls|lf]⌊orm⌋
prajudiziert. Freilich nicht,
daß wir gläserne Würfel haben wohl aber die
Geometrie des Würfels.
| | |
| | | / | | |
Wenn wir nun aber einen solchen
Würfel sehen, sind damit wirklich schon alle
Gesetze der möglichen Zusammenstellung
gegeben?! Also die ganze Geometrie?
Kann ich die Geometrie ˇdes Würfels von
einem Würfel ablesen.
| | |
| | | ∫ | | |
Muß ich nicht dazu in ihm schon eine sehr
einfach ausgesprochene Regel sehen?
| | |
| | | / | | | Der Würfel ist dann
eine Notation der Regel.
Und hätten wir
eine solche Regel gefunden, so könnten wir sie wirklich
nicht besser notieren, als durch die Zeichnung eines Würfels
(und daß es hier eine Zeichnung tut, ist wiederum ungemein
)
| | |
| | | / | | |
Und nun ist die Frage: inwiefern
kann der Würfel oder die Zeichnung (denn die beiden
kommen hier auf hinaus) als Notation
der geometrischen Regeln dienen?
| | |
| | | / | | | Doch auch nur sofern er
einem System angehört: nämlich der Würfel mit der
einen roten Endfläche wird etwas anderes notieren, als eine
Pyramide mit quadratischer roter Basis, etc.
D.h., es wird dasjenige Merkmal der Regeln
notiert worin sich z.B. der
Würfel von der Pyramide unterscheidet.
| | |
| | | / | | | Und das bringt
mich wieder darauf, daß ja jede Erklärung eines Zeichens statt
des Zeichens sollte dienen können.
D.h. wenn ich ein Zeichen durch
Erklärungen gleichsam aufbaue, dann muß das Aufbauen mit dem
Resultat des Aufbauens äquivalent sein. (Da
es nie auf (verschiedene) Attribute
ankommt.)
| | |
| | | / | | |
25. „Es liegt
schon in der Negation, daß
sie verdoppelt sich selbst aufhebt”.
Das was schon ‚darinliegt’ kann man immer nur
durch eine Regel , weil ˇman es nicht ausdrücken kann
es darin liegt, sondern nur
detachiert.
Darum ist
‚~’ in
~~p = p
keine Negation.
| | |
| | | / | | |
Das einzige Korrelat, in der Sprache, zu
einer Naturnotwendigkeit ist eine willkürliche Regel.
Sie ist das einzige, was man von dieser Notwendigkeit in
abziehen
kann.
| | |
| | | ? / | | |
„Ich sage doch diese Worte
nicht bloß, sondern ich meine auch etwas mit
ihnen” Wenn ich
z.B. sage „Du darfst nicht
hereinkommen” so ist es der natürliche Akt, zur
Begleitung dieser Worte, mich vor die Tür zu stellen &
sie zuzuhalten. Aber es wäre nicht so
offenbar naturgemäß wenn ich sie ihm bei
diesen Worten öffnen würde. Diese Worte
haben, wie sie hier verstanden werden, offenbar etwas mit
d jenem Akt zu tun.
Der
Akt ist sozusagen eine Illustration zu ihnen –
müßte als Sprache aufgefaßt werden können.
Andrerseits ist er aber auch der Akt den ich
abgesehen von jedem Symbolismus aus meiner Natur
.
| | |
| | | ∫ | | | Der Satz ist eben das
Motiv Motiv Handlung.
| | |
| | | | | | Die Negation im Satz ist wie der
hölzerne Würfel. Sie negiert ja
etwas & kann nur so bestehen. [ negieren. ]
| | |
| | | / | | |
Die gramm. Regel spiegelt in der
Sprache die Weise, wie wir die Negation befolgen.
| | |
| | | | | | Wie ich einen Befehl befolge zeigt doch
wohl, wie ich ihn verstehe [ auffasse. ] Aber das Band zwischen
Befolgung & Befehl ist der unsichtbare
(gläserne) Würfel Körper
des Symbols, der in den
Regeln der Sprache sichtbar gemacht wird.
| | |
| | | / | | | Jedes Zeichen der Negation
ist gleichwertig jedem andern, denn
„” ist ebenso ein Komplex von Strichen, wie das Wort
‚nicht’ & zur Negation wird es nur durch die
Art wie es ‚wirkt’. Hier aber
ist nicht die Wirkung im Sinne der Psychologie (das Wort
‚Wirkung’ also nicht kausal) gemeint, sondern die
Form seiner Wirkung.
| | |
| | | / | | |
ˇIch möchte sagen:
Nur dynamisch wirkt das Zeichen, nicht statisch.
Der Gedanke ist dynamisch.
| | |
| | | ∫ | | | Das heißt doch,
nur wenn ich mich danach richte, wirkt das Zeichen als
Zeichen. (Geld wirkt nur als Geld wenn ich es
für etwas bekomme oder hergebe.)
| | |
| | | ∫ | | | Wenn ich mich nach dem Satz
‚~p’
richte, so ist das, was ich tue
naturlich auch durch die Negation
charakterisiert. Aber ich kann den Anteil den die Negation
an der Bestimmung meiner Handlung hat nicht in
einem beschreiben, er ist ja eben durch die
Negation ausgedrückt; wohl aber kann ich die
interne⌊n⌋ Eigenschaft⌊en⌋ der Negation durch die
Regeln zeigen die vom Verneinungszeichen gelten.
| | |
| | | ∫ | | | Meine Aufgabe
ist es nur alles zu beachten was zwar jeder weiß aber als
wesentlich beachtet hat.
| | |
| | | ∫ | | |
„Nein so habe ich das Wort
… a ˇgar nicht
gemeint, nicht in dem Sinne in dem man sagen kann …
fa, sondern in dem Sinne von
… φa.”
| | |
| | | ∫ | | | Denke, wie
ich die Verneinung eines Satzes in die Tat umsetze. Da
muß ich doch eben von den Eigenschaften jenes Körpers Gebrauch
machen, der hinter dem Worte ‚nicht’ liegt.
| | |
| | | ∫ | | |
Ich könnte etwa sagen, wie sich Würfel zueinander
verhalten hängt zwar von ihrem Material ab, aber bei gegebenem
Material hängt ist das Verhalten der Körper von
ihrer durch ihre Gestalt ab.
bestimmt.
| | |
| | | / | | |
Wenn ich die Verneinung übersetze, so
muß ich doch von ihren geometrischen Eigenschaften Gebrauch
machen.
| | |
| | | ∫ | | |
Denken wir uns den Fall, daß ich auf einem Plan durch
Schraffierung einer Stelle andeute, daß Stelle nicht zu betreten ist.
| | |
| | | ∫ | | | Ich möchte
sagen: die Verneinung hat außer ihren logischen
Eigenschaften auch noch physikalische.
| | |
| | | ∫ | | |
26. Bedenke, daß man
auch dem Kind die Negation nur an ˇdiversen
einzelnen Beispielen vorführt
& ihr Verständnis beibringt.
beibringt. |
| | |
| | | / | | |
Jeder der einen
Satz liest und versteht sieht die
Worte
verschiedenen
Wortarten |
in verschiedener Weise obwohl sich ihr Bild
& Klang der Art nach nicht unterscheidet.
Wir vergessen ganz, daß ‚nicht’
& ‚Tisch’ &
‚grün’ als S Laute
oder Schriftbilder betrachtet sich nicht wesentlich voneinander
unterscheiden & sehen es nur klar in einer uns
fremden Sprache.
| | |
| | | ∫ | | |
Die Wörter haben offenbar ganz
verschiedene Funktionen im Satz. Und diese Funktionen
scheinen uns ausgedrückt in den Regeln die von den
Wörtern gelten.
| | |
| | | ∫ | | |
Man denke nur daran, was es heißt daß
sich ein Wort auf diesen Bereich des Satzes
bezieht!
| | |
| | | ∫ | | |
Denken wir an eine Sprache, in der die
Negation durch [d|D]rehen des Satzbildes um 180˚
ausgedrückt würde! Wäre es hier
nicht besonders klar daß das gedrehte Bild an sich nicht
wesentlich anders aussähe als jedes andre &
also das Wesen der Negation nicht zum
Ausdruck
| | |
| | | / | | |
Beim Lesen eine[s|r]
schleuderhaft⌊en⌋
geschriebenen Schrift kann man
erkennen, was es heißt etwas in das gegebene Bild
Gebilde hineinsehen. [ erkennen, wie man etwas in das
gegebene …).
| | |
| | | ∫ | | | Alles das scheint
aber doch nur statisch zu sein, nicht dynamisch.
| | |
| | | ∫ | | | Ein
umgestürzter Sessel wird anders wahrgenommen, wenn er als solcher
erkannt wird, als, wenn er blos als
Holzkonstruktion ohne
Bezug auf eine andre mögliche Lage gesehen wird. [ … als, wenn er als ˇeine Holzkonstruktion in
ihrer gegebenen Lage hingenommen
wird.[)| ] ]
| | |
| | | ? / | | | Denke an die
Vexierbilder. Ein Komplex von Strichen wird als das umgekehrte Bild
eines Mannes erkannt & gesehen.
| | |
| | | ∫ | | | Wenn man eine Uhr abliest, so
sieht man einen Komplex von Strichen, Flecken etc., aber auf ganz bestimmte Weise, wenn man ihn als
Uhr & Zeiger
will.
| | |
| | | ∫ | | |
Wenn ich etwa sage: „es ist 7 Uhr, da muß ich
gehen”, da war es nicht genug, einfach den Komplex von
Strichen etc. ‚statisch’ zu
sehen.
| | |
| | | ∫ | | |
27. Was nicht aus der
Quelle rinnt, kann nicht ˇim Fluß fließen.
| | |
| | | / | | | Das
‚[n|N]icht’ macht eine
Geste.
| | |
| | | ∫ | | | ethische Rechtfertigung einer must appeal to the man ich sie rechtfertigen will
rechtfertige |
. [ … dem ich sie
begreiflich machen will. ]
| | |
| | | ∫ | | | Ein Element der Beschreibung
kann Beschreibung nicht charakterisieren.
| | |
| | | ∫ | | | Wenn ich dem Befehl
folge so verstehe ich ihn darin in gewissem Sinne.
Kann ich ihn aber auch verstehen, ohne ihm zu folgen?
D.h. ist das Verstehen wesentlich ein Teil
des Befolgens?
Das Verstehen ist das
Verstehen, & das Befolgen ist das Befolgen.
| | |
| | | ∫ | | |
Das Verstehen der Verneinung ist das
sehen ihrer abwehrenden Geste.
| | |
| | | / | | | Oder:
Das Verstehen der Verneinung ist dasselbe, wie das Verstehen
einer abwehrenden Geste.
Und was ich
oben über ‚statisch’ &
‚dynamisch’ gesagt habe, bezieht sich auch
ganz auf Geste.
| | |
| | | ? ∫ / | | | Wir
können sagen: Ich kann mir denken, daß ich diese
Geste wahrnehme, & sie nicht
‚abwehrend’ empfinde. Denn die bloße
vorgestreckte Hand & der
zuruckgelehnte Körper ist nicht mehr
abwehrend als ein Kegel oder Wasserkrug.
Ich möchte sagen: es ist die Wirkung der
Bewegung auf mich, die das [a|A]bwehrende
ausmacht. Aber es ist nicht die Wirkung, denn von der
wüßte ich nicht, die Ursache & ein
Medicament das dieselbe Wirkung hätte
(welche immer sie sein mag) würde ich nicht abwehrend
nennen.
Es ist, wie ich mich früher
ausdrückte, ‚die Art wie ich diese Bewegung
sehe’. Aber das wäre wieder statisch.
Ich glaube, es ist, daß sich etwas bestimmtes in mir nach
dieser richtet.11
| | |
| | | / | | |
Aber was in
dieser Behauptung ist nun bloße Hypothese
(Mythologie)?
| | |
| | | ∫ | | |
Was ist z.B.
der logische Gehalt dieser meiner
Aussage: „Die ‚abwehrende
Geste’ habe nicht mehr
Abwehrendes, als irgend eine Bewegung oder
Körperform”?
Das heißt
doch, : Die Beschreibung dieser
Bewegung allein
beschreibt das Abwehren nicht. D.h.
es hat Sinn von dieser Bewegung , sie sei eine abwehrende Geste.
| | |
| | | / | | | Und
nun will ich sagen: Es liegt nicht an der speziellen
Bewegung, daß sie an ⌊&⌋ für sich keine
abwehrende Geste ist, sondern eine Bewegung ist an &
f sich überhaupt keine Geste.
Es ist liegt natürlich auch nicht,
daß daran daß sie keine ruhende Attitüde ist sondern
Bewegung, denn die diese Bewegung ist an sich, in
meinem Sinn, ebenso ‚statisch’ wie die ruhende Stellung.
| | |
| | | / | | | Die
Gebärdensprache ist eine Sprache & wir haben
sie nicht – im gewöhnlichen Sinne – gelernt.
Da[ß|s] heißt: sie wurde uns nicht
(absichtlich,) geflissentlich
gelehrt. Und doch haben wir sie gelernt. –
| | |
| | | ∫ | | | Ich kann die
abwehrende Geste auch verstehen, wenn sie einem Andern gilt.
| | |
| | | / | | | Chinesische
Gesten verstehe⌊n⌋ ich wir so wenig, wie
Chinesische Wörter Sätze.
| | |
| | | ∫ | | |
(Die Geste muß, um verstanden zu
werden, wie jedes Zeichen als Bild, das heißt als Angehöriger
eines Systems aufgefaßt werden.)
| | |
| | | / | | | Man könnte sich das
Lernen einer Sprache analog dem Fingerhutsuchen
vorstellen, wo die gewünschte Bewegung durch
‚heiß, heiß’, ‚kalt, kalt’
herbeigeführt wird. Man könnte sich denken,
daß der Lehrende statt dieser Worte auf irgend eine Weise
(etwa durch Minen) angenehme & unangenehme
Empfindungen hervorruft, & der Lernende nun dazu gebracht
wird, die Bewegung auf den Befehl hin
auszuführen, die regelmäßig von von der
angenehmen Empfindung begleitet wird (oder zu ihr
führt).
Wir könnten uns denken,
daß er auf diese Art abgerichtet wird, auf gewisse Zeichen in
bestimmter Art zu reagieren. (Und Abrichten geschieht
wirklich so.)
| | |
| | | / | | |
Hätten wir nun dadurch den Zeichen
folgen gelernt, so verhielte es ˇsich so: Wir
würden beobachten, daß wir bei gewissen Bewegungen &
Worten des Andern reflexartig gewisse Bewegungen machen &
würden dies nachträglich dadurch erklären, daß
diese Bewegungen uns seinerzeit zu angenehmen Empfindungen
verholfen haben.
Diese Erklärung verhielte sich
zu unseren Handlungen so, wie die
Darwinsche Erklärung des
Stirnrunzelns – aus einem gewissen Nutzen den es unsern
tierischen Vorfahren gebracht habe – zu dem Akt des
Stirnrunzelns, der jetzt keine Beziehung zu diesem Zweck hat.
Die Erklärung wäre eine hypothetische &
würde die Ursache der Handlung betreffen, nicht das
Motiv.
| | |
| | | ∫ | | |
Denken wir uns eine Sprache in der jeder Befehl durch eine
Vorführung mit Puppen etc. gegeben
wird. Hier ist das Folgen viel leicher als ein
einer-Regel-Folgen erkennbar.
Oder noch einfacher, daß der Befehlende uns alles
(selbst) vormacht.
| | |
| | | ∫ | | |
(A. I don't agree with you there.
B. Allright, then I won't agree
with you either.)
| | |
| | | / | | |
28. Es ist sehr
sonderbar: Das Verstehen Wir sind versucht
das Verstehen einer Geste möchten wir durch Worte ihre
Übersetzung in Worte erklären, & das Verstehen von
Worten durch diesen entsprechende Gesten. [ Es ist
sehr sonderbar: Wir sind versucht das Verstehen
einer Geste durch, ihr entsprechende, Worte zu erklären, &
das Verstehen von Worten durch, diesen entsprechende
Gesten. ]
| | |
| | | / | | |
Und wirklich werden wir Worte durch eine
Geste & eine Geste durch Worte erklären.
| | |
| | | ∫ | | | Es besonders schwer, uns zurückzuhalten, in
der Philosophie hinter die Erscheinungen dringen zu
wollen.
| | |
| | | / | | |
Das Abbilden (Nachahmen)
enthält wesentlich eine gewisse Bereitschaft –
Empfänglichkeit, die Bereitschaft sich führen zu
lassen, sich nach dem Modell zu richten, die Funktion zu sein,
zu der das Argument das Modell sein wird.
Und wirklich ist der Ausdruck dafür der, daß
ich gleichsam x² oder
( )²
bin & wenn nun das Modell 5 ist, so
ergibt es ‚„von selbst”
5². (Sich für das Modell unbestimmt halten,
von ihm bestimmen
lassen.) (﹖)
| | |
| | | / | | | Wenn ich nun
x² war & es kommt
die 5 daher, so müßte es nun daraus allein folgen,
daß ich zu
5²
werde.12
| | |
| | | / | | |
Und das ist in einem Sinn der Fall & in einem andern
nicht. Es ist nicht der Fall in dem Sinn ich Handlung nicht
als die Befolgung eines Befehls durch vergleichen
der Handlung mit dem Befehl erweisen kann. Und es ist der
Fall in dem Sinn, in dem ich die Handlung durch
Collationieren mit dem Befehl rechtfertigen
kann.
| | |
| | | | | | Ich bin
x², nun kommt die 5 daher
& ich werde nun
5².
Nun kann ich die
5²
mittels der 5 und x² in einem Sinne
rechtfertigen, in einem andern nicht. Und ich möchte
sagen– , :
soweit ich sie nicht rechtfertigen kann, hat es keinen Sinn das Wort
„rechtfertigen” zu gebrauchen.
| | |
| | | | | | Ich kann
die
5²
mittels x² rechtfertigen wenn
ich dabei x² einem
x³ oder einem anderen
Zeichen des Systems entgegenstelle.
| | |
| | | ∫ | | | Der Satz
„wenn 6 gekommen wäre, wäre ich
6²
geworden”, muß in der allgemeinen Bereitschaft
liegen. Also in dem x².
| | |
| | | | | | Die Schwierigkeit ist offenbar, das nicht zu
rechtfertigen versuchen, was keine Rechtfertigung
verträgt
besitzt [ zuläßt ] |
| | |
| | | | | | Wenn man fr[ä|a]gt:
„warum schreibst Du
5²?”
& ich antworte „es steht doch da, ich soll
quadrieren”, so ist das eine Rechtfertigung – &
ein volle –. Eine Rechtfertigung
verlangen in dem Sinne in dem dies keine ist, ist
sinnlos.
| | |
| | | ∫ | | |
Wenn das keine Rechtfertigung ist, so
gibt es keine.
Das ist es, was wir eine Rechtfertigung
nennen.
| | |
| | | / | | |
Ich hätte jemanden alle
möglichen
Erklärungen dafür gegeben, was der
Befehl „quadriere diese Zahlen”
heißt. (Und sind doch sämtlich Zeichen.)
Er quadriere darauf & nun frage ich ihn „warum
tust Du das auf diese Erklärungen
hin?” Dann hätte es keinen Sinn mir zu
antworten: „Du hast mir doch gesagt: (folgt
die Wiederholung der Erklärungen)”. Eine
andre Art der Antwort ist aber auf diese Frage auch nicht möglich
& die Frage heißt eben nichts. Sie
müßte sinnvoll lauten: „Warum tust Du
das & nicht jenes auf diese Erklärungen
hin (ich habe Dir doch gesagt …)”.
| | |
| | | / | | | Wenn man nun
fragen würde: Wie lange vor der Anwendung der Regel
muß die Disposition „x²” gedauert
haben? Eine Sekunde, oder zwei? Diese Frage
klingt natürlich, und mit Recht, wie eine
Persiflage. Wir fühlen, daß es darauf gar nicht
ankommen kann. Aber diese Art
(der) Frage taucht immer
wieder auf.
| | |
| | | / | | |
„Die Weise” “ wie ich mich
nach der Regel richte; wenn dieses Wort überhaupt einen Sinn
haben soll, muß das sein, was durch eine weitere Regel
über die Anwendung der ersten ausgedrückt ist.
Ist eine solche weitere Regel nicht vorhanden, so gibt es
keine Weise der Anwendung der ersten, sondern nur ihre
Anwendung. Eine Weise ist dies, im Gegensatz zu einer
andern Weise.
| | |
| | | | | | Warum sollte ich mir vor der
Ausführung der Quadrierung
des Quadrierens |
die Regel wiederholen? Denn, wenn ich im Stande bin sie
zu wiederholen dann kann ich sie ja auch gleich
anwenden. Den Wortlaut der allgemeinen Regel wiederholen,
hätte nur Sinn, wenn ich sie im Gegensatz zu anderen
Regeln hervorheben will. Weil das allgemeine
Zeichen der Regel ja nicht magisch wirkt, sondern nur insofern Sinn
hat als es auf eine Stelle eines Systems zeigt.
| | |
| | | ∫ | | | Die Grammatik
beschreibt das System, den Raum, an dessen eine Stelle das
zeigt.
| | |
| | | ∫ | | | Wir müssen in gewissem
Sinne wissen, was statt des Regelausdrucks
der Regel |
x² alles stehen
könnte, um dieses Zeichen zu verstehen.
| | |
| | | ? | | | Könnte man also
sagen: Das Zeichen muß, um verstanden zu werden, als
Argument in eine Funktion fallen, die eben de⌊n⌋ Raum
characterisiert in dem dann das Zeichen die
Stelle im Gegensatz zu anderen Stellen anzeigt?
| | |
| | | ? | | | Darum kann das
Zeichen ohne Grammatik nicht existieren.
| | |
| | | ∫ | | | Das Zeichen ohne Grammatik
wäre das ‚statische’.
| | |
| | | ? | | | Das heißt, ich kann auch
eine Geste nicht verstehen, wenn ich sie nicht als eine
Möglichkeit in einem bestimmten Raum sehe. Und also
gibt es auch eine Grammatik der Gesten (nämlich ihre
Geometrie)
| | |
| | | | | | Wenn ich die Geste des
Urzeigers verstehen soll, so muß ich sie als den
einen Wert einer bestimmten Variablen auffassen. Die
Grammatik sagt mir die möglichen Stellungen des Uhrzeigers,
d.h. gibt mir diese Variable.
| | |
| | | | | | Nun, glaube ich, sehen wir auch den
Grund, warum uns der Gedanke in gewissem Sinne als
ergänzungsbedürftig, unvollständig, erschien.
| | |
| | | | | | Man kann zu einem Zeichen, etwa dem
Pfeil ↗
der eine bestimmte Richtung andeuten soll, die
Erklärung hinzusetzen: Im Gegensatz zu
↑ oder
↖.
Und obwohl das keine erschöpfende Grammatik ist, so zeigt
⌊es⌋ doch, daß wir damit eine Erklärung
andeuten können, daß, was in dieser Erklärung
angedeutet wird, im Verständnis irgendwie
mit verstanden
sous-entendu |
ist.
| | |
| | | ∫ | | |
1.3. Ich : in welcher Richtung wird wohl der Pfeil zeigen;
– & nun zeigt er in dieser.
| | |
| | | ∫ | | | Der Raum in dem der
Pfeil aufgefaßt wird, kann nicht durch ein dem Pfeil in irgendeiner
Weise , Zeichen
charakterisiert werden. Denn die gleiche
Unbestimmtheit müßte auch diesem Zeichen eigen sein.
| | |
| | | ∫ | | | Jeder Satz
sagt: es ist so, & nicht anders.
Darum kann man die Sprache nicht beschreiben.
| | |
| | | ∫ | | |
Sieht man das gerade, aufgeknüpfte
Stück des Fadens, so ist es schwer zu erkennen, welches
Stück des verknoteten Fadens es früher war. Man
erkennt in der Lösung nicht mehr die Probleme, die sie
gelöst hat.
| | |
| | | ? / | | |
Nicht darin besteht das Abbilden
der Strecke a daß ich daneben die gleichlange a'
setze, sondern 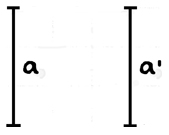 darin, daß
a, in die allgemeine Disposition eingesetzt, a'
ergibt. darin, daß
a, in die allgemeine Disposition eingesetzt, a'
ergibt.
Die allgemeine Disposition wird
dadurch beschrieben, daß ich sage: wenn a doppelt so
lange gewesen wäre, hätte ich auch
a' doppelt so lange gemacht.
(etc.)
| | |
| | | ? / | | | Wenn man
fragt: „Warum muß denn die Sprache Grammatik
haben? das muß doch mit ihrer Anwendung zu tun
haben”. So müßte ich
sagen: Ja, denn wie sollte ich sonst etwas
beschreiben, einer Tatsache einen Satz zuordnen, wenn ich nicht
in einem bestimmten System das passende wählen könnte, oder
– was auf dasselbe hinauskommt – nach einem
bestimmten System wählen könnte. Sonst
wäre müßte ja die Zuordnung
willkürlich sein. Und umgekehrt, wie sollte ich mich nach einem
Zeichen richten, ihm eine Bewegung, Handlung, zuordnen, wenn nicht
nach einem System.
| | |
| | | / | | |
Wenn ich mich mit der Bewegung des Punktes
P von A nach B
 nach dem Pfeil
↗
richte nach dem Pfeil
↗
richte so ist, was hier geschieht
so ist
das |
nur
dadurch beschrieben, daß ich das System von Pfeilen beschreibe, dem
dieser angehört. – Ich könnte nun wohl
sagen: Ist das genug? muß ich nicht auch die
Regel ˇangeben nach der ˇdie Übersetzung
geschieht, z.B. hier, daß ich mich parallel
zum Pfeil bewegen muß? Aber diese
Übersetzungsregel ich mir in
Gestalt etwa des Zeichens „❘ ❘”
(im Gegensatz etwa zu „❘ –”)
dem Pfeile zugesetzt denken; aber dann würde das Zeichen
„↗❘ ❘”
auf keiner anderen Stufe stehen wie „↗”
& ich könnte doch jetzt nur das System beschreiben dem
dieses Zeichen angehört, wenn ich nicht ad infinitum,
also erfolglos, weitere Zeichen zu dem obigen setzen
will.
| | |
| | | ∫ | | |
Du sagst hier, daß, was geschieht, wenn ich mich nach
einem Zeichen richte, nicht damit beschrieben ist, daß das Zeichen
& meine Handlung beschrieben werden; sondern, daß
dazu auch noch die Grammatik des Zeichens
werden muß.
Was natürlich nicht dasselbe heißt, wie, daß, der sich
nach dem Zeichen [r|R]ichtende sich des
Ausdruckes der gramm.
Regeln bewußt ist. Wohl aber, daß einem andern
Ausdruck [ andern Regeln ] auch ein anderer Vorgang
des sich-danach-Richtens
Nachbildens |
entspricht.
| | |
| | | / | | |
Das Wort „entsprechend”
„in
Übereinstimmung
mit” |
(dem
Pfeil, z.B.) hat keinen Sinn, wenn es sich
nicht auf ein System bezieht, dem der Pfeil angehört.
| | |
| | | ∫ | | |
2. Ein
Zeichen wirkt nicht durch sein suggestives Aussehen, sondern durch das System dem es
angehört.
| | |
| | | / | | |
3. Denken wir uns
daß das Schachspiel nicht als Brettspiel erfunden worden wäre
sondern als ein Spiel das mit Ziffern & Buchstaben auf Papier
zu spielen ist & so daß sich niemand dabei ein Quadrat mit
64 Feldern etc. vorgestellt hätte. Nun
aber hätte jemand die Entdeckung gemacht, daß dieses
Spiel ganz einem entspricht das man auf einem Brett in der &
der Weise spielen könnte. Diese Erfindung
wäre eine große Erleichterung des
Spiel[es|s]
gewesen (Leute denen es früher zu schwer gewesen
wäre könnten es nun spielen). Aber es ist klar
daß diese ˇneue Illustration der Spielregeln nur ein neuer
leichter übersehbarer Symbolismus wäre der
im übrigens mit dem geschriebenen auf gleicher Stufe
stünde. Vergleiche nun damit das Gerede
darüber daß die Physik heute nicht mehr mit mechanischen
Modellen sondern „nur mit Symbolen”
arbeitet.
| | |
| | | ? / | | |
Wenn man fragte: Aber
wäre es ˇnicht doch möglich von dem was beim
Quadrieren von 5 in x²
geschieht nur Rechenschaft zu geben indem man ˇnur
sagt daß ich vom Zeichen x² beeinflußt unter
‚5”
5²’ geschrieben habe; so
ist die Antwort muß ich
fragen: aber woher weiß ich, daß es auf den Einfluß
de[r|s] x² geschehen ist? Das ist
doch nur eine Hypothese & eine die mich hier gar nicht
interessieren kann. Dann kann ich also nur sagen daß
x² dargestanden hat
und daß ich
5²
unter die 5 geschrieben habe!
Und nun ist
es klar daß alles was ich erklären will gerade das
„daher” ist.
| | |
| | | ∫ | | | Und nur dieses Daher
erklärt das System wird
System erklärt, & nur das System erklärt
.
| | |
| | | / | | | Wir stoßen hier immer
auf die Pei peinliche [f|F]rage ob
denn nicht das Anschreiben des 5²
(z.B.) mehr oder weniger (oder ganz)
automatisch erfol⌊g⌋t sein könne, & fühlen
daß das der Fall sein mag & daß es uns gar nichts
angeht. Daß wir hier auf ganz irrelevantem
Boden sind, wo wir nicht hingehören.
| | |
| | | / | | | Wir möchten
nämlich sagen: Soweit das Hinschreiben
automatisch erfolgt geht es uns nichts an & es hat keine
Deutung eines Zeichens stattgefunden. – Erst wenn ich
das was ich , durch ein Zeichen
rechtfertige, liegt in dieser Rechtfertigung der Hinweis auf
das, was in den Regeln der Grammatik ausgedrückt
ist.
| | |
| | | / | | |
Das heißt: Wenn immer ich
ξ schreibe
weil hier η steht setzt dieses
‚Weil’ eine Regel voraus.
| | |
| | | ∫ | | | Ich kann doch
am Schluß nicht mehr sagen als jeder weiß.
| | |
| | | ∫ | | |
Ich kann doch
nur auf das auf das
aufmerksam machen, was jeder weiß,
d.h. sofort als wahr
zugibt.
(Das
Sokratische
Erinnern an die Wahrheit)
| | |
| | | ∫ | | | „Ich schreibe
‚5²’, weil hier
‚x²’
steht”. Was aber, wenn ich sagte:
„Ich schreibe ‚+’, weil hier
‚σ’
steht”? Man würde
fragen: Schreibst Du denn überall
‚+’ wo
‚σ’
steht? D.h. man würde nach
einer allgemeinen Regel fragen. Und das
‚weil’ im letzten Satz hätte sonst keinen
Sinn.
| | |
| | | ∫ | | |
Ich meine also, das ‚weil’
(hier) bezieht sich auf eine allgemeine
Regel, d.h., es muß sich immer durch eine
allgemeine Regel ergänzen lassen.
| | |
| | | / | | | Gehen wir zum Uhrzeiger
zurück: Gewiß stellen wir uns den Uhrzeiger nicht
in verschiedenen Stellungen vor, wenn wir seine gegenwärtige
Stellung ablesen (auch würde uns das nicht helfen).
Und vielleicht, wenn wir sagen „es ist 5 Uhr, ich muß
gehen” sagen wir
d[a|ie]s &
gehen automatisch. Aber ich hätte ja auch, wie der
Betrunkene, auf die Streichholzschachtel sehen können
& sagen „Donnerstag, da muß ich
gehen”. Und soweit Ursache und Wirkung in Frage
kommen, sehe ich zwischen den beiden Fällen keinen
Unterschied.
| | |
| | | ∫ | | |
Kann ich aber einfach so sagen:
Wo immer so ein ‚weil’
(‚deswegen’, etc)
steht, da kann ich eine allgemeine Regel aussprechen,
die den Vorgang ˇ﹖ beschreibt.
| | |
| | | / | | | Wenn also Einer sagt
„5 – da muß ich
5²
schreiben”, so muß dazugeschrieben
werden können:
„weil ich jede Zahl ˇdie mir unterkommt
quadrieren muß”, & zwar darf dieser Zusatz der
Tatsache nichts hinzufügen.
| | |
| | | ∫ | | | Der Pfeil allein zeigt
nicht.
| | |
| | | | | | Es kann keine
Diskussion darüber geben, ob diese Regeln oder andere die
richtigen für das Wort ‚nicht’ sind.
Denn das Wort ‚nicht’ hat ohne
Regeln noch keine Bedeutung & wenn
wir die Regeln ändern, so hat es nun eine andere Bedeutung
(oder keine) & wir können dann ebensogut auch das
Wort ändern. Daher sind diese Regeln willkürlich,
weil, die Regeln erst das Zeichen machen.
| | |
| | | / | | |
Ich
habe die
durch den Ausdruck auf eine Weise
erhalten. Diese Weise ist das Konstante in den Fällen
,
,
etc ist also durch das System der Zeichen
f(x) gegeben.
Diese Weise kann dadurch au⌊s⌋gedrückt werden, daß
ich sage: ich setze in den Ausdruck f(x) für
x 5 ein
(die Zahl ein, die mir gegeben wird). Bestimmt das
nicht schon die Grammatik des Zeichens
„” etc?
| | |
| | | / | | | Ich benütze das Zeichen
„” um von 5 zu
zu
gelangen.
| | |
| | | / | | |
Die Rechtfertigung, daß ich
‚’
schreibe, weil da
‚’ steht, sagt
natürlich nichts andres, als: „ˇich habe
aus
gewonnen”. Und hier kann man
fragen: „wie?” & die Antwort
muß eine Regel sein, die sich nicht nur auf das Zeichen
‚’ bezieht, denn
man brauchte dieses Zeichen nicht, wenn es allein stünde.
Daß ein Zeichen mich so leiten kann, setzt voraus,
daß es mich auch anders hätte leiten können.
| | |
| | | ∫ | | |
4.
Das Beobachten dessen, wie die Sprache gebraucht
wird [ Die Beobachtung des Sprachgebrauchs als
eines Phänomens ] liefert uns die Grammatik
nicht, denn aus dieser Beobachtung man z.B. schließen,
daß das gleiche Wort i[m|n] ⌊den⌋
S[a|ä]tz⌊en⌋ ‚die Rose ist rot’
&
‚2 × 2 ist
4’ vorkommt & also die gramm. Regeln dieses
Vorkommen erlauben.
| | |
| | | / | | |
Man muß wissen worauf im Zeichen man zu
sehen hat. Etwa: auf welcher Ziffer der Zeiger steht,
nicht darauf, wie lang er ist.
| | |
| | | / | | |
„Geh in der Richtung in der der
Zeiger zeigt”.
„Geh so
viele Meter in der Sekunde als der Pfeil
cm
lang ist”.
„Mach so viele Schritte
als ich Pfeile zeichne”.
„Zeichne
diesen Pfeil nach.”
Für jeden dieser
Befehle kann der gleiche Pfeil stehen. ‒ ‒ ‒
| | |
| | | / | | | Ist es so:
Den Befehl zum Motiv meiner Handlung nehmen heißt, das
Gleiche wie: während man handelt wissen, daß
man den damit den Befehl befolgt oder ihm
entgegen handelt?
| | |
| | | / | | |
Es heißt offenbar etwas:
„wissen, daß man den Befehl befolgt” &
darin muß das enthalten sein, was in den
gramm. Regeln ausgedrückt
ist.
| | |
| | | ∫ | | |
Was ich hier versuche ist, keine Hypothese über
die Ingerrenz der gramm. Regeln zu machen,
sondern nur zu sagen, was sicher ist.
| | |
| | | / | | | Es zeigt mir jemand zum
ersten Mal eine Uhr & will daß ich mich nach ihr
richte. Ich frage nun: worauf soll ich
bei diesem Ding achten. Und er sagt: Auf die
Stellung der Zeiger.
| | |
| | | ∫ | | |
Es kommt nicht darauf an, ob ich
während meiner Handlung mir bewußt war, daß ich dem Befehl
gemäß handle. Aber wenn ich
nac, auch nachträglich, die Handlung
mit dem Befehl vergleiche, um sie etwa zu rechtfertigen,
muß ich dabei den Befehl verstehen, d.h.
dieses Vergleichen hängt vom grammat⌊i⌋schen Raum ab, in
dem der Befehl existiert der durch die gramm. Regeln gegeben
ist. Denn dann muß ich den Pfeil
verschieden verstähen
jenachdem er verschieden erklärt
| | |
| | | / ∫ | | |
„Folge der Richtung des Pfeils” das gibt die
ganze Grammatik des Pfeils.
Das Wort
‚Richtung’ ist die Variable die den Raum
darstellt.
| | |
| | | ∫ | | |
Die Grammatik beschreibt, wie die Zeichen
verwendet werden. Aber nicht, wie sie einer Reihe von
Beobachtungen zufolge verwendet werden, sondern die Verwendung
in jedem einzelnen Fall.
| | |
| | | | | | „Ich
muß auf die Länge achten”, „ich muß auf
die Richtung achten”, das heißt schon: auf diese
Länge im Gegensatz zu anderen, etc.
| | |
| | | / | | | Kann man
nun auch, ohne der Richtung des Pfeils zu folgen, auf seine Richtung
achten? (Denn das heißt so viel
wie: kann man verstehen ohne zu übersetzen?)
| | |
| | | ? / | | |
„Folge dem Pfeil” hat gar keinen Sinn, wenn es
nicht eine Abkürzung einer bestimmten Erklärung
(von mehreren möglichen) ist.
| | |
| | | ∫ | | | Und wenn ich nun
das Zeichen ↗
irgendwie auffasse & mich danach richte so
muß mir keine solche Erklärung gegenwärtig sein
(und wäre sie es, so müßte ich sie ja selbst
wieder irgendwie als Zeichen in einem System verstehen
& sie würde mir also nichts helfen) aber das was ich
tue wird durch eine solche Erklärung beschrieben, es
entspricht einer solchen Erklärung. Die
aber, da sie selbst ein Zeichen ist mir nicht das Wesen des
Zeichens aufbauen helfen kann.
| | |
| | | ∫ | | |
5.
Zeitliches Verhältnis des
„geh zur Tür hinaus” & der Handlung,
die ihn befolgt.
Denken wir uns den
Befehl durch ein Trompetensignal gegeben.
Und
den Unterschied zwischen dem Befolgen des Befehls „geh zur
Tür hinaus” & eines Befehls, der mir
etwa jeden Schritt zur Tür vorzeichnet.
Offenbar ist der obere Befehl einem Element des andern gleich analog.
| | |
| | | ∫ | | |
„Das steht das Wort
‚[B|b]lau’, also muß ich diese Farbe
nehmen”.
| | |
| | | ∫ | | |
Käme das Wort ‚blau’
in einer anderen Sprache vor, & hieße dort, was
auf Deutsch ‚rot’ heißt, so würde ich mich
in meinen Handlungen auch danach zu richten haben, ob der
Befehl deutsch oder in der andern Sprache gegeben wurde.
| | |
| | | | | | Wir nehmen das Signal zum Motiv unserer
Handlung.
| | |
| | | / | | |
Warum schreibst Du
25? – Weil dort ‚y’ steht. – Ja ist das das Signal für 25? –
Nein, aber ich habe ‚25’ geschrieben, weil dort
‚y’ steht. – Woher weißt Du
dann, daß Du es deswegen geschrieben hast?
| | |
| | | ∫ | | | Denken wir an die
verification von Sätzen
(nicht die Befolgung von Befehlen). Denn die
Rechtfertigung nach der Befolgung ist ja nur eine
Verification wie jede andre.
Aber: ich habe den Befehl p befolgt heißt nichts
andres als, der Befehl war p und ich habe p getan.
| | |
| | | ∫ / | | | Was
heißt es aber: Ich geh zur Tür weil der
Befehl gelautet hat „geh zur Tür”?
Und wie vergleicht sich dieser Satz mit: ich
geh zur Tür obwohl der Befehl gelautet hat „geh zur
Tür”. Oder: Ich geh zur Tür
aber nicht weil der Befehl lautete „geh
z.T.”,
sondern …
Oder: ich geh
z.T.
nicht z.T. weil der
Befehl gelautet hat „geh z.T.”.
| | |
| | | ∫ | | |
Heißt „ich habe es getan, weil
Du es befohlen hast” nicht dasselbe wie:
„Du hast es befohlen & ich habe es
gewünscht”?
| | |
| | | ∫ | | |
6. Nein: Ich
sage „ich tue das weil A es mir befielt,
nicht weil B es befielt”.
| | |
| | | ∫ | | | Das ‚ich
tue’ kann ich immer durch ein ‚ich
wünsche’ übersetzen, weil ich nicht der Herr meiner
Handlungen bin.
| | |
| | | ∫ | | |
„Ich wünsche, daß sein
Wunsch erfüllt wird”. Damit meine ich nicht
nur: ich wünsche, was er wünscht, sondern auch ich
wünsche seine Befriedigung.
| | |
| | | ∫ | | |
7. Die
gramm. Regeln haben Bedeutung wo
sie gebraucht werden; und nur dort.
| | |
| | | / | | | „Wie kann das Wort
‚nicht’ verneinen?” Ja haben
wir denn
Verneinung durch ein Zeichen noch einen Begriff von der
Verneinung?
Doch es fällt uns dabei
etwas ein wie: Hindernis, abwehrende Geste,
Ausschluß. Aber das alles
(ist) doch immer in einem Zeichen
verkörpert.
| | |
| | | / | | |
Wie soll ich mich nach der Uhr
richten? Wie kann ich mich nach diesem Bild
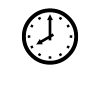 richten? Wie nach jedem
andern
richten? Wie nach jedem
andern
| | |
| | | ∫ | | |
Die gr.
R. haben nur dort Bedeutung
wo ich nicht anders kann als sie gebrauchen.
| | |
| | | ? / | | |
Die Zeigerstellung
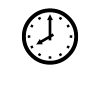 könnte mir
natürlich auch als unabhängiges Signal erklärt
werden, indem mir gesagt würde:
„Sieh immer wieder auf die Uhr & wenn sie
einmal so ↖
ausschaut, dann …”. Das wäre so wie:
Wenn Du einmal ein Trompetensignal hörst, dann
…. könnte mir
natürlich auch als unabhängiges Signal erklärt
werden, indem mir gesagt würde:
„Sieh immer wieder auf die Uhr & wenn sie
einmal so ↖
ausschaut, dann …”. Das wäre so wie:
Wenn Du einmal ein Trompetensignal hörst, dann
….
| | |
| | | / | | |
Das heißt übrigens, daß ich nicht von einer
allgemeinen Regel für ein Zeichen reden muß, denn
die Regel kann lauten: „Wenn Du in einer halben
Stunde läuten hörst, dann …” & nur
für dieses Mal gelten. Eine Allgemeinheit gibt es
freilich auch hier, da ich mich nach dem genauen Zeitpunkt des Signals
zu r⌊i⌋chten habe. Aber auch das kann
wegfallen, wenn es heißt: „Wenn es genau in
einer halben Stunde läutet, dann komm; wenn es zu dieser Zeit
nicht läutet, dann nicht.”
| | |
| | | | | | Wenn einer fragt „wie kann das Wort
‚nicht’ verneinen”, so könnte man als
Antwort fragen: Wie kann der Pfeil
↙
eine Zeit angeben (& er kann's wenn wir in ihm
den Stundenzeiger einer Uhr sehen) Aber wie
kann der Ausdruck „7 Uhr” eine
(Zeit) angeben? Und das
Zeig Zeichen ‚7’ (wie alle
Ziffern von 0 bis 9) ist gerade so ein Signal, von dem
man sich wundern kann, daß es eine Zahl bezeichnetn
kann.
| | |
| | | | | |
8
„Ich muß jetzt gehn”. –
„Warum?” – „Weil der
Pfeil in dieser ↙
Richtung zeigt” – „Zeigt
Dir ˇalso der Pfeil die Richtung d⌊ie⌋ Du zu
gehen hast?” – „Nein, er zeigt,
daß es 7 Uhr ist & um 7 Uhr muß ich
gehen”.
| | |
| | | ? / | | |
Und was ich sagen will,
ist, daß ich ursprünglich, als ich sagte „ich muß
jetzt gehen weil der Pfeil so zeigt”, mich nach ihm
in dem einen & nicht in dem andern Sinne gerichte⌊t⌋
habette. Daß
also diese Erklärung (daß der Pfeil mir die Zeit &
nicht die Bewegungsrichtung anzeigt) eine Beschreibung des
früheren Vorgangs ist & nicht eine neue Tatsache, die mit
der ersten etwa kausal zusammenhinge.
| | |
| | | ∫ / | | | Könnte
ich einfach so sagen: Die Bedeutung eines Wortes spielt
eine Rolle in seiner Anwendung & die gr. Regeln beschreiben
seine Bedeutung.
| | |
| | | / | | |
Man könnte z.B.
ausmachen, im Deutschen statt ‚nicht’ immer
‚not’ zu setzen & dafür statt
‚rot’ ‚nicht’. So
daß das Wort ‚nicht’ in der Sprache
bliebe. Und doch könnte man nun sagen daß
‚not’ so gebraucht wird, wie
früher ‚nicht’ & daß jetzt
‚nicht’ anders gebraucht wird
als früher.
| | |
| | | ? ∫ / | | |
Man sucht nie tief
genug nach dem philosophisch Bedeutsamen,
d.h. man steigt nicht tief genug in das herab.
| | |
| | | ∫ | | |
Man könnte auch so sagen:
Das Wort muß im Satz seine Bedeutung haben.
D.h. es muß sie mitführen.
Und erst sie macht den Satz zum Satz.
| | |
| | | ? / | | | Er
Es ist eine andere Versuchung anzunehmen daß beim
Aussprechen des Wortes, nicht wenn es mit
Bedeutung gebraucht ˇ(gedacht) wird, ein sehr
komplizierter
stattfinden
m[uß|üss]⌊e⌋,
der etwa solange dauert, wie das Aussprechen des
Wortes & sehr rasch vor sich geht. Dies ist –
natürlich – ebensowenig der Fall, wie, daß man beim
Ablesen der Uhr in Gedanken irgendwie einen komplizierteren
Vorgang ausführt als der durch die Zeigerstellung
gegebene. So ein komplizierterere
Vorgang Tätigkeit
würde uns ja doch nichts helfe. Warum sollte denn der
Vorgang gerade komplizierter sein müssen?!
Nein. Der Zeiger in diesem Raum gesehen, ist nicht
komplizierter; & ‚nicht’ als
Verneinung gesehen ist nicht
komplizierter. Die Regeln beschreiben nicht einen
komplizierten Vorgang der hinter den Zeichen .
| | |
| | | ∫ | | |
Ist nicht, was ich jetzt versuche, immer
wieder, die gramm. Regeln durch
etwas anderes – eine andere Beschreibung – zu
ersetzen. Denn wenn sie allein es tun können, dann ist
es eben nur allein mit ihnen
gesagt.
| | |
| | | / | | |
Und ist alles, was ich sagen , damit gesagt: Man kann nicht von
den gr. Regeln sagen, sie seien
eine Einrichtung dazu, daß die Sprache ihren Zweck erfüllen
könne. Wie man etwa sagt: wenn die
Dampfmaschine keine Steuerung hätte so könnte der Kolben
nicht hin & hergehen wie [es|er] soll.
Als könne man sich eine Sprache auch ohne Gr. denken.
| | |
| | | ∫ | | | Denn wenn ich mich in meiner
Handlung nach dem Pfeil richte, so kann ich mich in
verschiedener Weise nach ihm richten. Das heißt, wie
immer ich mich nach ihm richte, so kann ich dies (etwa
nachträglich) als eine Weise im Gegensatz zu einer
anderen beschreiben.
| | |
| | | / | | |
10. Die
Gr. R. sind, wie siec nun einmal
das sind, Regeln des Gebrauchs der Wörter.
Übertreten wir sie, so können wir deswegen die
Wörter dennoch mit Sinn gebrauchen. Wozu wären
dann die gr. R.
da? Um den Gebrauch der Sprache im ganzen
gleichförmiger zu machen? (etwa aus
aesthetischen Gründen?)
Um den Gebrauch der Sprache als gesellschaftlicher Einrichtung zu
ermöglichen? also wie eine Verkehrsordnung damit
keine Kollision ?
(Aber was geht es uns an
macht es uns |
,
wenn eine entsteht?) Die
Collision die nicht darf, darf nicht entstehen können!
D.h. ohne Gramm. ist es nicht eine schlechte
Sprache, sondern keine Sprache.
| | |
| | | / | | |
Aber die Notwendigkeit der
gramm. kann
wieder nicht ausgesprochen werden, sondern nur die Gr. selbst
(beschrieben werden). Sie ist
eben nicht vergleichbar einer Verkehrsordnung.
| | |
| | | / | | | Anderseits muß man doch
sagen, die Gramm. einer Sprache
allg als allgemeinen
anerkannten Institution ist eine
Verkehrsordnung. Denn da[s|ß] man
das Wort „Tisch” immer in dieser Weise
gebraucht ist nicht der Sprache als solcher
wesentlich, sondern quasi nur eine praktische
Einrichtung.
| | |
| | | / | | |
Was aber nun der Sprache „als
solcher” wesentlich ist, wie kann man das
beschreiben? Es ist auch in jener Institution gegeben,
nämlich eben darin, daß sie gebraucht werden
kann. Auch darin daß ich die
Gramm. ändern kann.
| | |
| | | ∫ | | | Die Frage
ist: Wenn ich ‚nicht’ gebrauche,
in wiefern bediene ich mich der
gr. Regeln?
| | |
| | | / ∫ | | | Man
könnte auch so fragen: Ist der ganze Satz nur ein
unartikuliertes Zeichen in dem ich erst nachträglich
Ähnlichkeiten mit anderen Sätzen erkenne?
| | |
| | | ? ∫ | | | Wenn man
einen Satz sagt, so ist es als produziere man einen
Organismus. Und die Worte stehen nicht einzeln da, ja sie
sind auch nicht etwa verschmolzen, sondern da sie nur
Vordergründe sind, so haben sie allein überhaupt keine
Berechtigung & das, dessen
Vordergründe sie sind ist allein überhaupt
nicht denkbar.
| | |
| | | ? ∫ | | |
Sie sind nicht zueinander, was Ziegel
& Mörtel zueinander sind; sondern was Festigkeit, Ziegel
& Mörtel. Das heißt, sie sind nicht durch
Ketten
⌊ [ ⌋da[z|Z]wische⌊glieder⌋ ] miteinander
verbunden sondern wie sondern wie ein Glied mit dem
nächsten.)
| | |
| | | ∫ | | |
Ich müßte sagen können:
Mache eine Sprache, & sie muß eine
Grammatik haben.
| | |
| | | | | |
11. Was für eine Sprache immer
immer ich für eine Sprache |
konstruiere, sie
muß sich in eine bestehende übersetzen lassen,
& dann wird die Gramm. der
letzteren für die erstere gelten. Aber damit ist
für mich jetzt noch nichts gesagt.
| | |
| | | ∫ | | | Angenommen ich
gebra⌊u⌋che das gleiche Wort für rot &
hoch. Ich könnte dann scheinbar die
gr.
R. für beide
zusammenziehen & es wäre dann eben die logische
Summe der Kombinationen
Zusammenstellungen |
erlaubt. Denn es wäre nun, wenn
wir etwa das Wort „hoch” für beide
Fälle gebrauchen, erlaubt zu sagen, daß Blut hoch
sei.
| | |
| | | / | | |
Ja, man könnte unsere Frage in einer sehr elementaren Form
stellen: Warum eine Sprache nicht mit bloß einem Wort
auskommen könnte
möglich ist |
, da es ja doch
vorkommt daß ein Wort (in einer
Sprache) mehrere Bedeutungen hat (warum also
nicht alle?)
| | |
| | | / | | |
Gibt es so etwas wie eine komplette
Grammatik, z.B., des Wortes
‚nicht’?
| | |
| | | | | |
13. Das eine kann man sicher sagen, daß in
dieser Sprache diese Zusammenstellung keinen Sinn hat
kein Satz ist |
. Und daß dadurch kein Sinn
verloren geht. Und auch das sollte schon
gen[ü|u]gen
sein.
| | |
| | | ? / | | | Nun
möchte ich sagen: Und die Worte bestimmen allein den
Sinn des Satzes. Aber was heißt das
eigentlich? Da doch die Worte außerˇhalb
de[m|s] Satzes keine Bedeutung
haben. Ich möchte sagen: Um den Satz zu
verstehn braucht es keiner weiteren Abmachung als die Abmachungen
die [w|W]orte betreffen.
Das heißt eben um den Satz zu verstehen lernen wir nur Worte
verstehen. Aber am wir lernen die Worte
schon in Sätzen verstehen.
| | |
| | | ∫ | | |
Der Satz erklärt sich selbst.
| | |
| | | | | | Die ‚Abmachung’ als
Geschichte der Bedeutung eines Wortes hat für uns kein
Interesse. Sie scheint mir aber in einem logischen Sinn in
die Funktion eines Wortes einzutreten. Etwa so daß, wenn
man ein Wort versteht, man diesem Verständnis immer eine
Abmachung zu Grunde liegend denken kann.
| | |
| | | ∫ | | | Alles was ich mit Recht
über die Sprache sagen kann ist eben
uninteressant.
| | |
| | | / | | |
Das Wort ‚Teekanne’ hat
Bedeutung, gewiß, im Sinne Gegensatz zum Worte
Abracadabra, nämlich in der deutschen
Sprache. Aber wir könnten ihm natürlich auch eine
Bedeutung geben das wäre ein Akt ganz analog dem wenn ich
eine Täfelchen mit der Aufschrift
‚Teekanne’ an eine Teekanne hänge.
Aber was habe ich hier anders als eine Teekanne mit
eine[m|r] Tafel & auf der Striche
gemalt sind? Also wieder nichts logisch
interessantes. Die Festsetzung der Bedeutung eines Wortes
kann nie (wesentlich) von anderer
Art sein.
| | |
| | | ∫ | | |
17. „Der Pfeil
zeigt dorthin”: heißt das einfach er hat dort
seine Spitze?
| | |
| | | | | | Hat es also
keinen Sinn zu sagen der Pfeil A
↑
B
ist so gemeint daß er
auf B zeigt? Und das heißt natürlich etwas. Und zwar
etwa: „Gib acht, wohin das Schwanzende des
Pfeiles zeigt.”
| | |
| | | ∫ / | | |
Man sagt auch:
„Maßgebend ist nur, wohin
d[as|ieses] Schwanzen
Ende des Pfeil[s|e]s zeigt”.
| | |
| | | ∫ | | | Ist alles
ausgedrückt daß das
Wort „sich nach … richten” nur mit einer
Variablen gebraucht werden kann? Nämlich:
„sich nach der Richtung des Pfeiles
[R|r]ichten oder nach seiner Länge oder nach
dem Winkel, den diese beiden Geraden einschließen etc?
| | |
| | | / | | |
Nachtrag 3.5.
Ein gutes Bild: Der Mensch der in den Spiegel sieht
um sich zwinkern zu sehen; & was er nun
wirklich sieht. (Ungeeignete physikalische
Theorien)
| | |
| | | ∫ | | |
Man könnte ja glauben, daß das ‚zeigen’
des Pfeils mit einer etwa vorgestellten Bewegung
zusammenhängt. Daß man also quasi den
Pfeil quasi
fliegen sieht. Und das kann tatsächlich der Fall
sein. Aber das Symbol ist diese Bewegung, oder der Pfeil in
Bewegung, nicht.
| | |
| | | ∫ | | |
Der Pfeil zeigt in dieser
Richtung, darum gehe ich so, wenn er anders zeigen
würde etc.
| | |
| | | ∫ | | |
Ich folge ihm wohin er
geht.
| | |
| | | ∫ | | |
Nicht die anderen Lagen kommen in Betracht, sondern nur der Raum
(die Möglichkeit jener Lagen).
Aber
dieser Raum kann doch unmöglich beschrieben
werden: ich meine nicht im
Zeichen selbst.13
| | |
| | | | | |
Es
kann eben nur in der Grammatik, außerhalb des
Satzes, beschrieben werden.
| | |
| | | ∫ | | | Wie spielt er aber dann bei
der Verwendung des Zeichens eine Rolle? Beim
des Zeichens kann er es nicht,
denn, was erkannt wird, kann ich beschreiben & es
muß in der Beschreibung wieder aufscheinen.14
| | |
| | | ∫ | | | Was nur nachher
gesagt werden kann, kann nur nachher gesagt werden.
D.h., wenn es von der Verneinung in der
Grammatik gesagt werden kann, daß ~~p = p
ist, so muß das eben alles sein ‒ ‒ ‒
| | |
| | | ? / | | |
~~p = p
ist ja nicht eine nachträgliche Beschreibung der
Verneinung[,|.] [v|V]on der man fragen könnte, ob sie
schon früher gestimmt . Das ist die Versuchung, es
so anzusehen.
| | |
| | | ∫ | | |
„Ich brauche das Wort
‚~’ so, daß
~³p =
~p”, „Ich meine
‚Drehung um 180˚’ in dem
Sinne, daß 3 solche Drehungen dasselbe leisten, wie
eine”  Wie verhalt sich nun das Wesen
der einer halben Drehung zu dieser Regel?
Wie verhalt sich nun das Wesen
der einer halben Drehung zu dieser Regel?
(Übrigens genau so, wie das Wesen der Verneinung zu
jener.)
Die Regel scheint wie
ein Spiegelbild des Wesens in der Sprache. (Wie
eine Definition)
| | |
| | | / | | |
„Wenn Du das damit
meinst, dann gilt diese Regel” – wenn Du was
damit meinst? Nein, die Regel kann nur ein Ausdruck
sein, was gemeint ist.
| | |
| | | / | | | Ganz
richtig: wie ich früher einmal bemerkt habe; ich
lese die Regel von der Verneinung ab, wie einen Satz der Geometrie von
einer Figur.
| | |
| | | ∫ | | |
Wenn ich Regeln geben will, dann drückt
sich die Bedeutung der Zeichen in ihnen so aus.
| | |
| | | ∫ | | | Und wozu
dient mir denn die Regel ~³p =
~p? Wie gebrauche ich sie
denn? Dadurch, das ich mit ~³p
dasselbe meine, mit
~p?
| | |
| | | ∫ | | | Wie drückt
sich denn im Gebrauch der Wörter aus, daß ich mit
~³p
dasselbe meine wie mit ~p?
| | |
| | | ∫ | | | Was heißt es
wenn ich sage: „Ich schaue bei den 3 halben
Drehungen bloß auf das Resultat, & das ist dasselbe,
wie bei einer halben Drehung”?
| | |
| | | ∫ | | | Oder wenn ich sage:
„Daß ~³p =
~p ist, zeigt mir nur was an dem Zeichen
‚~³p’
”?
| | |
| | | ∫ | | | Aber das klingt wieder so,
als könnte ich dann das eigentliche Symbol aus allen
gleichbedeutenden Zeichen herausheben & brauchte dann
keine Grammatik mehr. Aber so ist es nicht.
| | |
| | | / ∫ | | |
„Ich folge der Richtung des Pfeils
↗
nicht seiner Länge” [Ist nicht schon alles
ausgedrückt?]
| | |
| | | / ∫ | | |
Ist es also so, daß in die
Beschreibung des Phänomens des Folgens die Variable
eintreten muß?
| | |
| | | ∫ | | |
Ich muß mit dem unmittelbar Gegebenen
auskommen.
| | |
| | | ∫ | | |
„Ich richte mich nach dem
Pfeil” muß heißen, daß meine
Handlung durch ihn bestimmt ist.
| | |
| | | ∫ | | | Und das heißt
doch wieder, daß sie aus dem Pfeil ableitbar ist.
Aber ableiten kann man nur aus einem allgemeinen
Ausdruck.
| | |
| | | / | | |
Alle Probleme verflüchtigen sich in
der [U|u]rsach- &
wirkungslosen Welt der Vorstellung.15
| | |
| | | / | | |
Wir sind
nicht im Reich der Erklärungen.
| | |
| | | ? / | | |
Sich nach einem Zeichen richten,
heißt, daß das Zeichen in eine variable Disposition eingesetzt,
die Handlungsweise ergibt.
| | |
| | | ∫ | | | Zeichen ist nur das,
wonach wir uns richten.
| | |
| | | ∫ | | |
Das Zeichen ist
Wert einer Variablen.
| | |
| | | ∫ | | |
Jeder Satz sagt: es ist so
& nicht anders
| | |
| | | ∫ | | | Jede Erklärung hiervon
scheine scheint unmöglich: ich meine
jede Beschreibung dieses Vorgangs.
| | |
| | | ∫ | | | Lesen der Karte:
Straßen, Flü[ß|ss]e, & andrerseits
Jägerhaus, Wirtshaus, Kirche, etc.
| | |
| | | / | | | Wir finden in uns
die Bedeutung eines Wortes vor, nicht anders, als wäre sie uns in
einer Erklärungstafel (Legende)
gegeben.
| | |
| | | / ∫ | | |
Das Wort Bedeutung, das nenne ich
„Symbol”.
| | |
| | | ∫ / | | |
„Die doppelte Negation
gibt eine Bejahung” das klingt ⌊so⌋ wie: Kohle
und Sauerstoff gibt Kohlensäure. Aber in Wirklichkeit
gibt die doppelte Negation nichts, sondern ist
etwas.
| | |
| | | ∫ | | |
„Wer die Negation versteht, der weiß, daß die doppelte Negation
… …”
| | |
| | | / ∫ | | |
Es täuscht uns da etwas
eine Tatsache vor.
| | |
| | | ∫ | | |
So als sähen wir ein Ergebnis des
logischen Prozesses. Während das Ergebnis nur das
des physischen Prozesses ist.
| | |
| | | ∫ | | | Jene Beweismethode der
indischen Mathematik: „[s|S]ieh die
Figur an, dann siehst Du …” hängt damit
zusammen.
| | |
| | | ∫ | | |
Die Beschreibung hat Sinn, die
 diese Ordnung von
Pfeilen beschreibt. diese Ordnung von
Pfeilen beschreibt.
| | |
| | | ∫ | | |
Die Substitution ist auch Zug eines Spiels & es kommt darauf an, wie man
sie gebraucht.
| | |
| | | | | | Man
kann eine Kreisfläche beschreiben, die durch Durchmesser in
8 congruente Teile geteilt ist, aber es ist
sinnlos das von einer eliptischen Fläche
zu sagen. Und darin liegt, was die Geometrie in
dieser Beziehung von der Kreis-
& Elipsenfläche aussagt.
| | |
| | | ∫ | | | Die Grammatik
beschreibt die Sprache als zeitliches Phänomen:
Aber ohne Bedeutung, d.h., die
Wichtigkeit, kann sie nur durch die Anwendung bekommen.
| | |
| | | ∫ | | | Denke nur
an's Schließen, das auch zeitlich vor sich geht.
| | |
| | | ∫ | | | Das
„dem Pfeile Folgen” muß auch ein Phänomen
sein, denn, was sollte es sonst sein.
| | |
| | | ∫ | | | Auch das Kind
lernt nur eine Sprache vermittelst einer anderen.
| | |
| | | / | | | Es lernt
die Wortsprache durch die Gebärdensprache. Aber das
Verständnis dieser müssen die Erwachsenen bei ihm
voraussetzen oder abwarten.
| | |
| | | / | | |
Niemand denkt daran das Kind die
Gebärdensprache zu lehren.
| | |
| | | / | | |
Niemand könnte daran denken.
| | |
| | | ∫ | | |
↗,
also ⋰ Warum liegt hier
der Ton auf einer Allgemeinheit, auf dem Einsetzen des Pfeiles in eine
allgemeine Formel?
| | |
| | | ∫ | | |
Es gibt keine Relation zwischen
5,
x², also 25.
| | |
| | | ? / | | |
Ich
collationiere etwa einen Linienzug nach einem
andern & sage: ja, es stimmt. Was
heißt das? In de[m|n] beiden
Linienzügen liegt das Stimmen natürlich nicht.
Und überhaupt nie in zwei Tatsachen. Von keiner
Tatsache kann man sagen, daß sie mit einer andern
übereinstimmt (natürlich auch mit keiner
psychischen). Es ist nicht vielleicht eine
besondere Eigentümlichkeit gewisser
seelischenr
Vorgänge, daß mit ihnen etwas übereinstimmen
kann.
¥ •
| | |
| | | ∫ | | |
Wie verwenden wir das Wort „es
stimmt”?
| | |
| | | ∫ | | |
Was heißt das: Ich trachte
diese Linie parallel jener anderen zu ziehen?
| | |
| | | ∫ | | | ⍈↺ (Wenn ich oben sage daß
„eine Tatsache mit einer anderen nicht
übereinstimmen könne”, so heißt das
selbstverständlich, daß es keinen Sinn hat so etwas
zu sagen.)
| | |
| | | ∫ | | |
Ich kupple die Handlung mit der
Vorlage.
| | |
| | | ∫ | | |
Inwiefern handeln die Regeln von diesem Wort (in diesem
Satz)?
| | |
| | | ∫ | | |
Es ist klar, daß das Reden
automatisch geschehen kann & uns dann nicht mehr
interessiert als irgend eine Bewegung oder ein Geräusch.
| | |
| | | ∫ | | | Ist es
so: Die Sprache (das Reden) interessiert uns nur
dann, wenn sie etwas .
| | |
| | | ∫ | | | Es muß
sich ergeben, daß man nach der Wirkungsweise der Sprache nicht
fragen kann.
| | |
| | | ∫ | | |
Und ich meine das so: daß die
Sprache am Ende doch nur Vorlage & Abbild
ist.
| | |
| | | ∫ | | |
„Deutlicher kann ich Befehl
nicht machen.”
| | |
| | | / | | |
Meine Anschauung könnte ich so
ausdrücken, daß im Satz „geh dort hin” die
Worte auch nur die gleiche Funktion haben, wie die
Handbewegung.
| | |
| | | / | | |
In welchem Sinne sagt man,
daß man kennt die Bedeutung des Wortes A noch ehe
man den Befehl in dem es vorkommt befolgt hat? Und
inwiefern kann man sagen, man hat die Bedeutung durch die
Befolgung des Befehls kennen gelernt? Können die beiden
Bedeutungen mit einander in Widerspruch stehen?
| | |
| | | ? ∫ / / | | |
Das
Fundamentale grammatisch ausgedrückt: Wie ist es mit
dem Satz „man kann nicht zweimal durch den gleichen Fluß
gehen?
| | |
| | | ∫ | | |
Ich wünsche, einen Apfel zu bekommen. In
welchem Sinne kann ich sagen, daß ich noch vor der
Erfüllung des Wunsches die Bedeutung des Wortes Apfel
kenne? Wie äußert sich denn die Kenntnis der
Bedeutung? d.h. was versteht man denn
unter ihr.
| | |
| | | ∫ | | |
Offenbar wird das Verständnis des
Wortes durch eine Wort[ä|e]rklärung gegeben;
welche nicht die Erfüllung des Wunsches ist.
| | |
| | | / | | | Übrigens Eines:
Der Satz „ich kann ihn zeichnen, wenn Du mir
einen Bleistift gibst”, [als Beweis des
Verstehens] wenn er gewiß ist & nicht erst durch die
Tat bewiesen wird, wird dann auch von einer Tatsache wahr gemacht, die
von jener Tat ganz unabhängig ist, & der Satz ist
dann auch richtig wenn die Zeichnung bei gegebener Gelegenheit
nicht ausgeführt wird. (Dadurch verliert
aber dann jener Satz für uns an Bedeutung.)
| | |
| | | | | | Jener Satz, wenn er gewiß ist
& nicht ‚erst’ durch die Tat bewiesen wird,
wird dann durch die Tat über haupt
nicht bewiesen & durch die entgegengesetzte wird
nicht sein Gegenteil bewiesen d.h. er
ist von dieser Tat einfach unabhängig.
| | |
| | | ∫ | | | Gibt es also
für uns in der Sprache nicht Wesentliches &
[u|U]nwesentliches? Hat also
Heraklit nicht wenigstens eine
wesentliche Eigenschaft unserer Sprache
hervorgehoben?
| | |
| | | / | | |
Denken wir uns den Standpunkt eines
Forschers: er findet, daß in der Sprache der Erde ein Zeichen
benützt wird, das nach diesen & diesen Regeln (etwa
nach denen der Negation) gebraucht wird, &
fragt sich: Wozu können sie das brauchen? Die
Antwort wäre aber: Wenn immer ein Zeichen mit diesen
Regeln zu gebrauchen ist. Und das
Zeichen dient zu nichts als als Angriffspunkt dieser
Regeln. Aber das ist sehr
unklar ausgedrückt. ‒ ‒ ‒
| | |
| | | ∫ | | | Die Sprache
gewinnt Bedeutung durch die Gelegenheit, bei der sie
gebraucht wird. Wir verwenden die Sprache ja nicht zum
Spaß.
| | |
| | | / | | |
Wir können in der alten
Ausdrucksweise sagen: das wesentliche am Wort ist seine
Bedeutung.
| | |
| | | ∫ | | |
„Der Träger
des [N|d]ieses Namens lebt jetzt
in Paris.”
| | |
| | | ∫ | | |
Das Wort hat eine
Bedeutung. Wie ist denn diese Bedeutung fixiert?
Anders als durch die Worterklärungen?
| | |
| | | / ∫ | | | Ich
könnte sagen: Wenn das Wort wirklich auf Etwas
deutet, so gehört dieses mit zum Symbol.
| | |
| | | / | | |
Es ist wirklich
„the meaning of meaning” was wir
untersuchen: die
Grammatik des Wortes „Bedeutung”.
| | |
| | | | | | Wir sagen: das Wesentliche am Wort
ist seine Bedeutung; wir können das Wort durch ein anderes
ersetzen das die gleiche Bedeutung hat. Damit ist gleichsam
ein Platz für das Wort fixiert & man kann ein Wort
für das andere setzen, wenn man es an den gleichen Platz
setzt.
| | |
| | | / | | |
Woher weiß ich das zwei Worte die gleiche Bedeutung haben? Doch entweder
dadurch, daß es heißt A = B, oder daß sie
beide auf die gleiche Art erklärt werden. Das heißt
aber, daß sie beide dasselbe Zeichen ersetzen
(A = C &
B = C)
Man könnte aber meinen, es gäbe eine Art der
Erklärung (gleichsam durch Anwendung) die nicht die
Ersetzung eines Zeichens durch ein anderes wäre! Wie
wenn man etwa dem Kind die Negation beibringt, indem man es
verhindert zu
tun.
Veranlassen wir es dadurch nicht, Worten
einen Sinn beizulegen, ohne daß wir sie durch ein anderes Zeichen
ersetzen, also ohne diesen Sinn auf andere Weise
auszudrükken.
Veranlassen wir es nicht gleichsam, für sich etwas zu
tun dem kein äußerer Ausdruck gegeben wird, oder
wozu der äußere Ausdruck nur im Verhältnis einer
Hindeutung eines Signals steht? Die Bedeutung
ließe sich nicht aussprechen, sondern nur auf sie von
ferne hinweisen. Aber welchen Sinn hat es dann
überhaupt, wenn wir von dieser Bedeutung
reden?
| | |
| | | ? / | | |
Denken wir uns einen Zerstreuten
der auf den Befehl „rechtsum” sich nach links
gedreht hätte & nun, an die Stirne greifend,
sagte „ach so –
‚rechts–um’!” &
rechtsum machte.
| | |
| | | ∫ | | |
„Ich gehe dahin, weil die
Kante des Zimmers so läuft”. –
„Was heißt das:
‚weil’?!”
| | |
| | | ∫ | | | Ich stampfe mit dem Fuß,
da kommt jemand ins Zimmer &, auf meine Frage
‚warum’, sagt er: „ich habe geglaubt,
dieser Lärm heißt, ich solle herein kommen”.
| | |
| | | / | | | Welcher Art
ist unsere Untersuchung? Untersuche ich die
Fälle, die ich als Beispiele anführe auf ihre
Wahrscheinlichkeit? oder
Tatsächlichkeit? Nein, ich führe nur an
was möglich ist, gebe also grammatische Beispiele.
| | |
| | | ∫ | | | Die Untersuchung ob
die Bedeutung eines Zeichens seine Wirkung ist, ist auch eine
grammatische Untersuchung.
| | |
| | | ∫ | | |
Kann Erfahrung (oder Experiment)
die Bedeutung eines Wortes bestimmen? Also hat das
Experiment ergeben: „dies ist die Bedeutung des
Wortes”. Aber hätten wir das nicht schon
angeben können?
| | |
| | | ∫ | | | Die
[I|i]nterne Relation kann man nicht betonen, weil
sie erst da ist, wenn die Ableitung schon
ist.
| | |
| | | ∫ | | | Die allgemeine
Disposition kann nur gegeben sein, wie ein allgemeiner Ausdruck
(variabler Ausdruck)
| | |
| | | | | | Kann man
sagen: nur insofern ist ↗
von ↗
abgeleitet, als man es dadurch rechtfertigen kann?
| | |
| | | ∫ | | | Gewiß ich
rechtfertige meine Handlung mit dem Paradigma.
| | |
| | | / | | | Das Phänomen
der Rechfertigung . Ich
rechtfertige das Resultat
3² durch
x². So schaut
jede Rechtfertigung aus.
| | |
| | | / | | |
In gewissem Sinn bringt uns das nicht
weiter. Aber es kann uns ja nicht weiter,
d.h. zu einem Fundament
dem Metalogischen |
, bringen.
| | |
| | | ? ∫ / | | |
Inwiefern kann man von dem, der auf das Wort
„hinaus!” das Zimmer verläßt,
sagen, : er habe sich nach diesem Wort
gerichtet?!
| | |
| | | ∫ | | |
Das Problem äußert sich auch in der
Frage: Wie erweist sich ein
Mißverständnis? Denn das ist dasselbe wie
das Problem: Wie zeigt es sich daß ich
richtig verstanden habe? Und das ist: Wie
kann ich die Bedeutung erklären?
Es
fragt sich nun: Kann sich ein Mißverständnis darin
äußern, daß, was der Eine bejaht, der Andere verneint?
| | |
| | | | | | Nein, denn dies ist, wie es
[;| ,] eine
Meinungs-verschiedenheit
& kann als solche aufrecht erhalten
werden. Bis wir annehmen der Andere habe
Recht ….
| | |
| | | / | | |
Wenn ich also, um das Wort
„lila” zu erklären, auf einen Fleck
zeigend sage „dieser Fleck ist lila”, kann diese
Erklärung dann auf zwei Arten funktionieren?:
einerseits als Definition die den Fleck als Zeichen gebraucht
& anderseits als Erläuterung? Und
wie das letztere? Ich müßte
annehmen daß der Andere die Wahrheit sagt & dasselbe sieht
was ich sehe. Der Fall, der wirklich vorkommt ist
der: A erzählt dem B in meiner Gegenwart daß
ein bestimmter Gegenstand lila ist. Ich höre
dieses Gesprac das, habe
Gegenstand auch gesehen
& denke mir: „jetzt weiß ich doch was
‚lila’ heißt”. Das heißt
ich habe aus jener Beschreibung
jenen Sätzen |
eine Worterklärung gezogen.
Ich
könnte sagen: Wenn das was A dem B
erzählt die Wahrheit ist, so muß das Wort
‚lila’ diese Bedeutung haben.
Ich kann diese Bedeutung also auch quasi hypothetisch
annehmen & sagen: wenn ich das Wort so
verstehe, hat A recht.
| | |
| | | / | | |
Man sagt: „ja, wenn das
Wort das bedeutet, so ist der Satz
wahr”.
| | |
| | | / | | |
Aber dieses „das”
muß doch irgendwie ausgedrückt sein.
| | |
| | | / | | | Nehmen wir an,
die Erklärung der Bedeutung war nur eine
Andeutung: konnte man da nicht sagen: Ja,
wenn diese Andeutung so verstanden wird, dann gibt das Wort
in dieser Verbindung einen wahren Satz etc. Aber
dann muß ˇnun dieses „so” ausgedrückt
sein.
| | |
| | | / | | |
Man könnte auch so fragen: Ist die Erklärung
etwas Exactes, oder muß sie nichts
Exactes sein?
| | |
| | | / ∫ | | | „In 5 Minuten wird hier ein
schwarzer Fleck erscheinen”
„In 5 Minuten wird hier ein schwarzer
 erscheinen” „Verstehst Du
das?”
erscheinen” „Verstehst Du
das?”
| | |
| | | / ∫ | | |
„Ein
 ist das: ist das:
 ” muß
◇◇◇ das muß auch in bestimmter Weise gemeint
sein. ” muß
◇◇◇ das muß auch in bestimmter Weise gemeint
sein.
Das heißt die Zeichenerklärung
muß auch in selbst so & so gemeint
sein.
Wie könnte man hier ein
Mißverstandnis aufdecken
(Verification des
Verstandnisses)
| | |
| | | ∫ | | | Ist wirklich das
Charakteristische des Folgens (Geführtwerdens),
daß es mit einer allgemeinen Regel
operiert?
↗
dann also ⋰. Daß ein
Prinzip des Folgens vorhanden ist?
| | |
| | | / | | | Könnte man
sagen: Wenn kein Mißverständnis
festzustellen ist, dann ist auch kein Unterschied der
Bedeutung.
| | |
| | | / ? ∫ | | |
Der Fleck
 als Zeichen, statt des
Wortes „Fleck” hat eben auch seine Grammatik
& zwar eine andere als er als Zeichen – etwa – dieser besonderen Gestalt
hat. als Zeichen, statt des
Wortes „Fleck” hat eben auch seine Grammatik
& zwar eine andere als er als Zeichen – etwa – dieser besonderen Gestalt
hat.
Aber wie ist uns denn die
gegenwärtig wir die
Zeichenerklärung geben?
| | |
| | | / | | |
Nicht „wie kann ich es
so verstehen” ist dies Problem, sondern
„wie kann ich es überhaupt in einer Weise, sozusagen,
auf einmal verstehen”
| | |
| | | / | | | So seltsam es
klingt: „die Worte
[„|‚]Linie’,
‚Fläche’, ‚Punkt’ sind
so verschieden wie eine Linie, eine Fläche &
ein Punkt.
| | |
| | | / | | |
„Ich habe etwas bestimmtes damit
gemeint als ich sagte …”. –
„Wann hast Du es gemeint & wie lange hat es
gebraucht. Und hast Du bei jedem [w|W]ort etwas
anderes gemeint oder während des ganzen Satzes
dasselbe?”
Man sieht klar:
hier ist eine Unklarheit in dem Gebrauch des Wortes
„meinen”
| | |
| | | / | | | Übrigens komisch,
daß wenn man bei jedem ˇ– sagen wir deutschen –
Wort etwas meint, eine ◇◇◇ Zusammenstellung solcher Worte
Unsinn sein kann!
| | |
| | | / | | |
Wiedererkennen:
„Diesen Mann habe ich gestern gesehen”. – „Woher weißt Du das?”
– „Ich erinnere mich an sein Gesicht.”
– „Woher weißt Du
das” Diese Frage ist ˇnun
sinnlos. Das Wiedererkennen des Menschen war
hypothetisch – das Erinnern nicht. Aber als
nicht-hypothetisch bürgt es auch nicht für etwas
anderes sondern nur für sich selbst.
| | |
| | | ∫ | | | Man
könnte sagen: Die Bedeutung des Wortes
„Tisch” gibt es nicht, nur die Verwendung.
Aber auch das ist irreführend.
| | |
| | | / | | | Gibt mir die
Erklärung des Wortes die Bedeutung, oder verhilft sie mir nur zur
Bedeutung? So daß also diese Bedeutung in der
Erklärung nicht niedergelegt wäre, sondern durch sie nur
äußerlich bewirkt, wie die Krankheit durch eine
Speise.
| | |
| | | / | | |
Zu sagen, daß der Satz ein Bild sei,
hebt gewisse Züge in der Grammatik des Wortes
„Satz” hervor.
| | |
| | | / | | | Woher die alten philosophischen Probleme ihre
Bedeutung?
| | |
| | | / | | |
Der Satz der Identität
z.B. schien eine fundamentale Bedeutung zu
haben. Aber der Satz daß dieser „Satz”
ein Unsinn ist, hat diese Bedeutung übernommen.
| | |
| | | / | | | Wie
unterscheiden sich dann die Sprachregeln von denen des
Benehmens?16
| | |
| | | / | | |
Wenn man kein
Ziel angeben kann, das nicht erreicht würde, wenn diese Regeln
anders wären.
| | |
| | | ∫ | | |
Bausteine die nach ihren Formen
benannt wären ‒ ‒ ‒
| | |
| | | | | | Woher die Bedeutung der Sprache? Kann
man denn sagen: Ohne Sprache könnten wir uns nicht
mit-einander verständigen. Nein, das ist ja
nicht so wie: ohne Telephon könnten wir nicht von
Amerika nach Europa reden. (Es
sei denn, daß wir unter „Telephon” jede
Vorrichtung verstehen welche etc
etc.)
| | |
| | | / | | |
Wir können aber sagen:
Ohne Sprache könnten wir die Menschen nicht
beeinflussen. Oder nicht trösten. Oder
nicht ohne ˇeine Sprache Häuser & Maschinen
bauen.
| | |
| | | / | | |
Es ist auch zu sagen,
ohne den Gebrauch des Mundes oder der Hände können sich
Menschen nicht verständigen.
| | |
| | | / | | | Das Paradox ist doch,
da[ß|s], daß die willkürliche Regel eine
Wichtigkeit für uns hat. Während sonst
gerade das Willkürliche uns nicht interessiert
(z.B. Spielregeln)
| | |
| | | / | | |
Die Lösung kann nur kommen, wenn man den Widerstand der
falschen Methode aufgibt.
| | |
| | | / | | |
Das Wort von den grammatischen Regeln die
willkürlich sind, muß ja auch irreführend sein.
Was heißt es denn: „sie lassen sich nicht
begründen”? Und was heißt es, zu sagen,
die Regeln eines Spiels seien willkürlich, & welche
Regeln sind es nicht?
| | |
| | | / | | |
Sie können nicht willkürlich in
dem Sinne sein, in dem man, dies von Regeln aussagt, die auch anders als
willkürlich sein könnten.
| | |
| | | / | | | Man würde sagen:
Die Regeln nach denen ein Dampfkessel bemessen wird, sind nicht
willkürlich im Gegensatz zu denen der Farbe womit man
seines Anstrichs.
| | |
| | | / | | |
In welchem Sinne kann ich sagen, der Satz
sei ein Bild? Wenn ich darüber denke, möchte
ich sagen: er muß ein Bild sein, damit er mir zeigen kann, was
ich tun soll, damit ich mich nach ihm richten kann. Aber,
ist die Antwort, dann willst Du bloß
sagen, daß Du Dich nach dem Satz richtest in
demselben Sinne in dem Du Dich nach einem Bild
richtest.
| | |
| | | / | | |
Ist jedes Bild ein Satz? Und
was heißt es etwa zu sagen daß jedes als ein Satz gebraucht
werden kann?
| | |
| | | ∫ / | | |
Ich kann die Beschreibung
des Gartens in ein gemaltes Bild, das Bild in eine Beschreibung
übersetzen.
| | |
| | | ∫ | | | Du brauchst ein Wort, aber es
muß sich doch in dem Gebrauch dieses Wortes zeigen, was es
bedeutet, denn wie soll es sich zeigen?
| | |
| | | / | | |
„Was ein Wort bedeutet, kann man
nicht
sagen”.
| | |
| | | / | | |
Ich kann die ganze Sprache zum voraus
beschreiben; ja, in gewissem Sinne auch aussprechen.
| | |
| | | | | | Kann ich mich nach einem roten
Täfelchen im Satz besser richten, als nach dem Wort
rot?
| | |
| | | / | | |
„Ja, aber das Wort rot hat mir einmal mit Hilfe eines
solchen Täfelchens erklärt werden
müssen”.
Vielleicht, aber das
rote Täfelchen ist Dir jetzt eben nicht gegeben.
Ja Du hast auch ganz vergessen wie Du eigentlich die
Bedeutung des Wortes „rot” gelernt hast
& Du gebrauchst es & es tut Dir dieselben Dienste wie
das rote Täfelchen (ja bessere).
| | |
| | | / | | | Man sollte also meinen,
daß man mit dem Wort ganz dasselbe & ebensogut meinen
kann, wie mit dem Täfelchen.
| | |
| | | / | | | Damit ist aber nicht
gesagt, daß nicht die Gebärdensprache die sich des roten
Gegenstandes bedient uns menschlich natürlicher
ist.
| | |
| | | ∫ | | |
Kann ich nicht mit „rot” dasselbe meinen,
wie mit dem roten Täfelchen, & kann ich nicht mit dem
roten Täfelchen auch etwas andres meinen, als was ich jetzt mit
„rot” meine?!
| | |
| | | ∫ | | |
Wenn die Sprache kein Bild ist &
macht uns doch klar, wie es sich in der Wirklichkeit
verhält, so ruft sie also Bilder hervor (kausal) deren Bild
sie nicht ist, die sie also nicht bestimmt.
| | |
| | | ∫ | | | Nun dann nenne ich
jene Bilder die eigentliche Sprache.
| | |
| | | ∫ | | | Dann gibt es aber nicht
prinzipiell Sinn & Unsinn unter unseren Zeichen.
Denn die Sprache ist sozusagen nicht verantwortlich für das,
was sie hervorbringt.
| | |
| | | / | | |
Wie verhält es sich mit dem
Blinden; kann ihm ein Teil der Sprache nicht
erklärt werden? Oder vielmehr, nicht
beschrieben werden?
| | |
| | | / | | |
Wenn das Wort ‚rot’
ebensogut ist, wie das rote Täfelchen, so sollte man glauben der
Blinde könne die Sprache ebenso wohl lernen wie ein
Sehender.
| | |
| | | / | | |
Könnte ich denn nicht z.B. annehmen daß er etwas
rotes sieht, wenn ich ihm auf den Kopf
schlage?
| | |
| | | / | | |
Das angenommen, so ist er doch für
das praktische Leben blind.
D.h. er reagiert nicht wie die
der normale Mensch. Wenn aber jemand mit den Augen blind
wäre, dagegen sich so benähme daß wir sagen müßten, er sieht mit den
Handflächen (dieses Benehmen ist leicht auszumalen),
so würden wir ihn als sehenden behandeln
& auch die Erklärung des Wortes ‚rot’
mit dem Täfelchen würden wir hier für möglich
halten.
| | |
| | | | | | Nehmen wir aber an,
ich wäre blind. Aber was hilft
das? Ich kann natürlich annehmen, daß ich mit den
Augen nicht mehr sehe. Aber hier bin ich im Reiche der
Tatsachen (nicht der Grammatik).
| | |
| | | / | | | Oder muß ich nicht jetzt
sagen: Die Gebärdenspr[ä|a]che gibt
es für den Blinden nicht & sie ist ein wesentlicher
Bestandteil unserer Sprache? Nein denn es kann
nur heißen daß ich durch meine Gebärden
nicht bewirke daß er Gebärden sieht. Vielleicht
aber ginge es auf ganz andre Weise.
| | |
| | | / | | | Ist der Blindgeborne in
einem andern Fall als der
Erblindete? Ich kann mir doch vorstellen,
daß auch der Blindgeborne ein visuelles
Innenleben hat, & wenn einer dazu eine Erklärung
verlangt, so will ich sagen, er habe die Eindrücke
geerbt. (Natürlich ist das ganz
gleichgültig). Nur ist er trotz dieser Annahme
für alle praktischen Zwecke ein Blinder. Und ich will
damit nur zeigen, daß es sich hier nicht um einen Unterschied der
Grammatik, also des
Wesentlichen der Welt, handelt, sondern um Tatsachen.
| | |
| | | | | | Ich könnte dem
Blinden die hinweisende Erklärung „das ist
„rot” nicht geben. Aber in
seiner Phantasie könnte er geben. Aber das würde für
praktische Zwecke keinen Unterschied machen.
| | |
| | | ? / | | | Wir
bezeichnen ja in der Geometrie auch sowohl Linien als auch Punkte, wie
Flächen & Körper mit Buchstaben.
| | |
| | | ∫ | | | Was heißt
[das| es]: Ich kann mir vorstellen daß
in 5 Minuten ein roter Kreis an dieser Wand erscheinen
wird.
| | |
| | | / | | |
Daß das Wort nur im Satzverband Bedeutung hat, heißt
dasselbe wie, daß Wörter von denen wir sagen, sie haben in
unserer Sprache Bedeutung in gewissen Zusammenstellungen
keinen Sinn ergeben. D.h.
nichts weniger Unsinniges als eine beliebige
Zusammenstellung von Lautreihen von denen wir nicht sagen sie
hätten Bedeutung.
| | |
| | | ∫ | | |
Kann man von einem Verstehen reden, für
das es kein exactes
Criterium gibt?
| | |
| | | ∫ | | | Oder für
von einer Unterscheidung des Verstehens, oder der Bedeutung,
für welche es kein
solches Criterium gibt?
| | |
| | | ∫ | | | Das heißt von einem
Unterschied der Bedeutung, der nicht in dem Unterschied zweier
Erklärungen gegeben ist?
Das heißt
aber: nicht endlich in dem Unterschied zweier Zeichen.
| | |
| | | / | | | Oder, was
noch sonderbarer wäre: Gibt es einen
Unterschied der Bedeutung, der sich erklären läßt
& einen, and der in einer
Erklärung nicht zu Tage tritt?
| | |
| | | ? / | | | Erfahrung ist
nicht etwas, das man durch Bestimmungen von einem Andren
abgrenzen kann, was nicht Erfahrung ist; sondern eine
logische Form
| | |
| | | / | | |
Wenn man sich die Namengebung durch
Etiquettierung der Gegenstände denkt,
so könnte man eine Farbe nicht in demselben Sinne
etiquettieren (ihr ein Täfelchen
anhängen) wie (etwa) einem
Menschen oder der Kreisform.
| | |
| | | ∫ | | |
Wenn mir bei den Worten „roter
Kreis” die Vorstellung eines roten Kreises
vorschwebt: wie verhalten sich die Worte zu dieser
Vorstellung?
| | |
| | | ∫ | | |
Die Vorstellung, die durch ein Wort erweckt
wird, dient im Gedanken nur wieder als Zeichen.
| | |
| | | / | | |
Ich kann doch offenbar eine
Erwartung einmal in den Worten „ich erwarte einen roten
Kreis” ein andermal statt der letzten Worte durch das
ˇfarbige Bild eines roten Kreises
ausdrücken. Aber in diesem Ausdruck
entsprechen den beiden Wörtern „rot”[,| &] „Kreis” nicht zwei Dinge.
Also ist der Ausdruck der zweiten Sprache von ganz anderer
Art.
| | |
| | | / | | |
Zeigt das nicht, daß die
Erklärungen „das ist rot”, „das ist
ein Kreis” noch nicht alles sind, sondern daß es eine
solche Erklärung gibt: „das ist ein roter
Kreis”
| | |
| | | / | | |
Es gäbe außer dieser auch eine
Sprache, in der roter Kreis durch
nebeneinanderstellen eines Kreises
& eines roten Flecks ausgedrückt würde (so wie
man etwa 3 Menschen & 3 Bäume mit
   , ,
   ,
aber auch mit
❘ ❘ ❘ ,
aber auch mit
❘ ❘ ❘  ,
❘ ❘ ❘ ,
❘ ❘ ❘  bezeichnen
könnte.) bezeichnen
könnte.)
| | |
| | | / | | |
Wenn ich nun auch zwei Zeichen bei mir
habe, den Ausdruck „roter Kreis” & das
farbige Bild, oder die Vorstellung, des roten Kreises, so wäre
doch die Frage: Wie ist denn dann das eine Wort der Farbe,
das andere der Form zugeordnet?
Denn man
scheint doch sagen zu können, das eine Wort lenke die
Aufmerksamkeit auf die Farbe, das andere auf die
Form. Aber was heißt das? Wie
kann man diese Wörter in dieses Bild übersetzen?
| | |
| | | | | | Oder auch:
Wenn mir das Wort ‚rot’ eine Farbe ins
Gedächtnis ruft, so muß sie doch mit einer Form verbunden
sein, wie kann ich denn dann von der Form abstrahieren?
| | |
| | | | | | Die wichtige Frage ist dabei
nie: wie weiß ich er wovon er abstrahieren
soll? sondern, : wie ist das überhaupt
möglich, ⌊?⌋ oder: was
heißt es?
| | |
| | | / | | |
Vielleicht wird es klarer, wenn man die
beiden Sprachen vergleicht, in deren einer ein rotes
Täfelchen & eines mit einem Kreis (etwa einem
schwarzen auf weißem Grund) die Worte „roter
Kreis” ersetzen; & in deren andren
statt dessen ein roter [k|K]reis gemalt wird.
Wie geht denn hier die Übersetzung vor
sich? Er schaut etwa zuerst auf das rote Täfelchen
& wählt einen roten Stift, dann auf den Kreis, &
macht nun mit diesem Stift einen Kreis.
Es
würde etwa zuerst gelernt daß das erste
Täfelchen immer die Wahl des Bleistiftes bestimmt, das zweite,
was wir mit ihm zeichnen sollen. Die beiden Täfelchen
gehören also verschiedenen Wortarten an (etwa Hauptwort und
Tätigkeitswort) In der zweiten Sprache
aber gäbe es nichts, was man hier zwei Wörter
nennen könnte.
| | |
| | | ∫ | | |
Der Befehl sei: „Stelle
Dir einen roten Kreis vor”. Und ich tue es:
Wie konnte ich den Worten auf diese Weise folgen?
| | |
| | | | | | Das ist doch ein dafür, daß wir den Worten auch ohne
Vorstellungen gehorchen können.
| | |
| | | / | | | Unsere größte
Schwierigkeit ist, die Welt zu nehmen, wie sie ist.
| | |
| | | ∫ | | | Wie kann ich es
rechtfertigen, daß ich mir auf diese Worte hin,
diese Vorstellung mache?
| | |
| | | / | | |
Oder: Wo endet die
Rechtfertigung? Denn wo sie endet, verlassen auch wir die
Betrachtung.
| | |
| | | ∫ | | |
Der Befehl lautet „schreibe ein
großes a” & ich schreibe: A
‒ ‒
| | |
| | | ∫ | | |
Nicht daß ich A schreibe ist die Tatsache, die uns
interessiert; ich hätte ja (durch einen
Labsus) auch B schreiben
können; aber daß ich das A nun als großes a
anerkenne. Aber besteht diese Anerkennung nicht nur darin,
daß ich, was ich getan habe mit dem Satz beschreibe:
„ich habe ein großes a
geschrieben”?
| | |
| | | / | | |
Wie könnte man mit dem das „A” rechtfertigen, oder
zeigen daß „E” falsch wäre!
| | |
| | | / | | |
„Du hast ja den Befehl gar nicht
befolgt. Ich habe gesagt ‚schreibe
a’ & Du hast ‚A’
geschrieben. Wo liegt da die Befolgung?”
Darauf müßte ich antworten: „Nein; es war ein
Zusammenhang zwischen den Worten & dem was
ich schrieb”.
| | |
| | | / | | |
Der „kausale
Zusammenhang” ist kein primärer Zusammenhang, es
heißt also auch nichts ihn fühlen (oder
ähnliches).
| | |
| | | ∫ | | |
„Eine Geste kann nur so &
so verstanden werden”. Das kann doch nur ein Satz
der Grammatik über das Wort ‚verstehen’
sein.
| | |
| | | / | | |
Ich sage: „was ich mir vorgestellt habe, war nicht
willkürlich (& kausale Bedingtheit ist keine
Bedingtheit), sondern es ist bestimmt durch ein
Wort”.
| | |
| | | ? / | | |
Diese
Abhangigkeit muß sich beschreiben
lassen: Weil Du das gesagt hast, habe ich mir
das vorgestellt.
Das
heißt,﹖
nur﹖, in dem was da beschrieben
wird, besteht die Abhängigkeit.
| | |
| | | / | | | Immer wieder ist
der Fehler, in den man zu fallen droht der, der in der Frage
ausgedrückt ist „sehen zwei Leute wirklich die
Farbe, wenn sie von Rot
reden”. (Wobei man nicht das
Criterium der Gleichheit bedenkt.)
| | |
| | | ∫ | | | In wiefern
kann ich sagen, daß was ich getan habe
Befehl gemäß war?
| | |
| | | / | | |
Die Rechtfertigung muß immer so
aus-schauen: Du sagtest, so … & ich tat
das ….
Und fragt man weiter, so
müssen Worterklärungen folgen. Und fragt
man, „warum hast Du A geschrieben, ich sagte ‚schreibe ein großes
A’?” so kann man sich zur
Rechtfertigung nur auf etwas von der Art der Tafel
großes a
großes
b
großes
c
| A
B
C
|
berufen. Anders kann eine Rechtfertigung nicht
aussehen.
| | |
| | | ∫ | | |
Wenn wir sagen die Philosophie soll nicht
aus Erfahrungssätzen bestehen, &
m so sagen wir schon, daß sie nicht in
Satzen über Raum, Zeit, Substanz,
Verneinung etc bestehen
soll.
| | |
| | | ? / | | |
Der Zweck der Grammatik ist nur der
Zweck der Sprache. Der Zweck der Grammatik ist der Zweck
der Sprache.
| | |
| | | / | | |
Die Wichtigkeit der Grammatik ist die
Wichtigkeit der Sprache.
| | |
| | | ∫ | | |
Die Grammatik beschreibt ja die Bedeutung
der Zeichen.
| | |
| | | / | | |
Denken [W|w]ir an die witzige
Bedeutung, die wir den grammatischen Spielen Lewis
Carrolls geben.
‒ ‒ ‒
| | |
| | | / | | |
Ich könnte fragen: Warum
empfinde ich einen grammatischen Witz in gewissem Sinne als
T tief? (Und das ist
natürlich die philosophische Tiefe)
| | |
| | | / | | | Die Worte, die einer bei
gewisser Gelegenheit sagt, sind in sofern nicht
willkürlich, als gerade diese in der Sprache, die er
sprechen will (oder muß) das meinen was er sagen will,
d.h. als gerade für sie diese grammatischen
Regeln gelten.
Was er aber meint, d.h. die
gramm. Regeln sind insofern nicht
willkürlich, als er einen bestimmten Zweck nur so glaubt
erreichen zu können.
| | |
| | | ? / | | |
Man könnte auch ein Wort
z.B. „rot” wichtig nennen, in
sofern als es oft & zu Wichtigem gebraucht wird im
Gegensatz etwa zu dem Wort „Pfeifendeckel”.
⌊⌊ˇ Und die Grammatik des Wortes ‚rot’ ist
dann wichtig, weil sie die Bedeutung des Wortes
‚rot’ beschreibt.*
⌋⌋
| | |
| | | | | |
19.6. [Was ich in der Zwischenzeit
geschrieben habe, will ich später hier nachtragen]
| | |
| | | ∫ | | | Ich
glaube jetzt daß es richtig wäre
Buch über mit Bemerkungen über die
Metaphysik als eine Art der Magie zu beginnen
| | |
| | | ∫ | | | Worin ich aber
weder der Magie das Wort reden, noch mich über sie lustig machen
darf.
| | |
| | | ∫ | | |
Von der Magie müßte die Tiefe beibehalten werden. –
| | |
| | | ∫ | | | Ja
das Ausschalten jeder der Magie hat
hier den Charakter der Magie selbst.
| | |
| | | ∫ | | |
Denn wenn ich damit anfing von der
„Welt” zu reden (und nicht von diesem
Baum oder Tisch) was wollte ich anderes als etwas Höheres in
meine Worte bannen.
| | |
| | | ø | | |
Fraze⌊r⌋s
Darstellung der magischen & religiösen Anschauungen der
Menschen ist unbefriedigend: sie läßt diese
Anschauungen als Irrtümer erscheinen.
| | |
| | | ø | | |
So war also Augustinus im Irrtum wenn er Gott
auf jeder Seite der Confessionen anruft?
Aber
– man sagen – wenn er
nicht im Irrtum war, so war es doch der
Buddhistische Heilige – oder welcher immer
– dessen Religion ganz andere Anschauungen zum Ausdruck
bringt. Aber keiner von ihnen war im Irrtum
außer wo er etwa eine Theorie aufstellte.
| | |
| | | ø | | |
Wenn Schon die Idee, den Gebrauch – etwa die
Tötung des Priesterkönigs – erklären zu
wollen scheint mir verfehlt. Alles was
Frazer tut ist, sie
Menschen, die so ähnlich denken wie er, plausibel zu
machen. Es ist sehr merkwürdig daß alle diese
Gebräuche endlich sozusagen als Dummheiten dargestellt
werden.
Nie wird es aber plausibel daß die
Menschen aus purer Dummheit tun.
Wenn er uns z.B. erklärt der König müsse in
seiner Blüte getötet werden, weil nach den Anschauungen der
Wilden, sonst seine Seele nicht frisch erhalten würde, so kann
man doch nur sagen: wo jener Gebrauch & diese
Anschauung zusammengehen dort entspringt nicht der Gebrauch der
Anschauung sondern sie sind eben beide da.
Es
kann schon sein, & kommt heute oft vor, daß ein Mensch
einen Gebrauch aufgibt nachdem er einen Irrtum erkannt hat auf den
sich dieser Gebrauch stützte. Aber dieser Fall besteht
eben nur dort wo es genügt den Menschen auf seinen Irrtum
[A|a]ufmerksam zu machen um ihn von seiner
Handlungsweise abzubringen. Aber das ist doch bei den
Religiösen Gebräuchen eines
Volkes nicht der Fall & darum handelt es sich eben
um keinen Irrtum.
| | |
| | | ø | | |
Frazer sagt, es sei sehr schwer den Irrtum in der Magie zu
entdecken – und darum halte sie sich so lange – weil z.B. eine Beschwörung die Regen
herbeiführen soll sich früher
oder später gewiss als wirksam
erweist. erscheint. Aber
dann ist es eben merkwürdig warum
da[n|ß]n die Menschen nicht früher darauf kommen
daß es ohnehin früher oder später regnet.
| | |
| | | ø | | | Ich
glaube daß das Unternehmen einer Erklärung schon darum
verfehlt ist weil man nur richtig zusammenstellen muß, was
man weiß
& nichts dazusetzen & die Befriedigung die durch die
Erklärung angestrebt wird ergibt sich von selbst.
Und die Erklärung ist es hier gar nicht die
befriedigt. Wenn z
Frazer anfängt
& uns die Geschichte von dem Waldkönig
von Nemi erzählt so tut er dies in einem Ton der
zeigt daß er fühlt & uns fühlen lassen will
daß hier etwas Merkwürdiges & Furchtbares
geschieht. Die Frage aber „warum geschieht
dies?”, wird eigentlich dadurch
beantwortet: weil es furchtbar ist. Das
heißt dasselbe was uns bei diesem Vorgang furchtbar,
großartig, schaurig ˇtragisch etc. vorkommt nichts weniger als trivial
& bedeutungslos vorkommt, das hat diesen
Vorgang ins Leben gerufen.
| | |
| | | ∫ o | | | Nur
beschreiben kann man hier & sagen: so ist das
menschliche Leben.
| | |
| | | ∫ | | |
∣ Ein Motto für dieses Buch:
„Seht ihr den Mond dort
steh[en|n]?
Er ist nur halb zu sehn, & ist doch rund &
schön[?|.”] ∣
| | |
| | | ø | | |
Die Erklärung ist im
Vergleich mit dem Eindruck, den uns das Beschriebene macht, zu
unsicher.
| | |
| | | ø | | |
Jede Erklärung ist ja eine
Hypothese
| | |
| | | ø | | |
Wer aber, etwa, von der Liebe
beunruhigt ist, dem wird eine hypothetische Erklärung wenig
helfen. – Sie wird ihn nicht beruhigen.
| | |
| | | ø | | | Das
Gedränge der Gedanken, die nicht herauskönnen, weil
(sie) sich alle vordrängen
wollen & so am Ausgang verkeilen.
| | |
| | | ø | | | Wenn man mit
jener Erzählung vom Priesterkönig von Nemi das
Wort „die Majestät des Todes” zusammenstellt,
so sieht man, daß die beiden Eins sind.
Das Leben des Priesterkönigs stellt das dar was
mit jenem Wort gemeint ist.
| | |
| | | ø | | | Wer von der
Majestät des Todes ergriffen ist, kann dies durch so ein
Leben zum Ausdruck bringen. – Dies ist
natürlich auch keine Erklärung sondern setzt nur
ein Symbol für ein anderes. Oder: eine Zeremonie
für eine andere.
| | |
| | | ø | | |
Einem religiösen Symbol
liegt keine Meinung zu Grunde.
Und
nur der Meinung entspricht der Irrtum.
| | |
| | | ø | | | Man möchte
sagen: Dieser & dieser Vorgang hat
stattgefunden; lach', wenn Du kannst.
| | |
| | | ø | | |
Die religiösen Handlungen, oder das religiöse Leben des
Priesterkönigs ist von keiner andern Art als jede echt
religiöse Handlung heute, etwa ein Geständnis der
S[a|ü]nden. Auch dieses läßt sich
„erklären” & läßt sich nicht
erklären.
| | |
| | | ∫ | | |
Weiß ich daß dieser Apfelbaum nicht
heuer Birnen tragen wird?
| | |
| | | ø | | |
20.6. In effigie verbrennen. – Das Bild der Geliebten küssen. Das
basiert natürlich nicht auf einem Glauben an eine
bestimmte Wirkung auf d[ie|en]
Gegenstände d[ie|en]
d[as|ies] Bild
darstellt. Es bezweckt eine Befriedigung & erreicht
sie auch. Oder vielmehr, es bezweckt gar nichts,
wir handeln eben so und fühlen uns danach befriedigt.
| | |
| | | ø | | |
Man könnte auch den Namen der Geliebten küssen
& hier wäre die Stellvertretung durch den Namen
klar.
| | |
| | | ø | | |
Der selbe Wilde der anscheinend
um seinen Feind zu töten, Bild durchsticht, baut seine Hütte aus Holz
wirklich & schnitzt seinen Pfeil kunstgerecht & nicht in
effigie.
| | |
| | | ø | | |
Die Idee daß man einen
leblosen Gegenstand zu sich herwinken kann wie man einen
Menschen zu sich herwinkt. Hier ist das Prinzip das der
Personification.
| | |
| | | ø | | | Und immer
beruht die Magie auf der Idee des Symbolismus & der
Sprache.
| | |
| | | ø | | |
Die Darstellung eines
[w|W]unsches ist eo ipso die Darstellung seiner
Erfüllung.
Die Magie aber bringt einen
Wunsch zu Darstellung; sie äußert einen
Wunsch.
| | |
| | | ø | | |
Die Taufe als Waschung.
Ein Irrtum entsteht erst wenn die Magie
wissenschaftlich ausgelegt wird.
| | |
| | | ø | | | Wenn die
Adoption eines Kindes so vor sich geht daß die Mutter es durch ihre
Kleider zieht so ist es doch verrückt zu glauben daß hier ein
Irrtum vorliegt & sie glaubt das Kind geboren zu
haben.
| | |
| | | ø \ | | |
Die Magie in
Alice in Wonderland beim Trocknen durch [v|V]orlesen des
Trockensten was es gibt.
| | |
| | | ø \ | | |
magischen Heilung einer
[k|K]rankheit bedeutet man ihr sie möge den
Patienten verlassen.
| | |
| | | ø \ | | |
Man möchte
nach der Beschreibung so einer magischen Kur immer
sagen: Wenn das die Krankheit nicht versteht, so
weiß ich nicht, wie man es ihr sagen soll.
| | |
| | | ø | | | Von den
magischen Operation sind die zu unterscheiden die auf
einer falschen, zu einfachen, Vorstellung der Dinge &
Vorgänge beruhen. Wenn man etwa sagt die Krankheit
ziehe von einem Teil des [k|K]örpers in den andern
oder Vorkehrungen trifft die Krankheit abzuleiten als wäre
sie eine Flüssigkeit oder ein Wärmezustand. Man
macht sich dann also ein falsches das heißt hier unzutreffendes
Bild.
| | |
| | | ø | | |
Welche Enge des seelischen
Lebens bei Frazer! Daher: welche
Unmöglichkeit ein anderes Leben zu begreifen als das
[E|e]nglische seiner Zeit!
[E|F]razer
kann sich keinen Priester vorstellen der nicht im Grunde ein
englischer Parson unserer Zeit
ist mit seiner ganzen Dummheit und Flauheit.
| | |
| | | ø | | | Warum sollte dem
Menschen sein Name nicht heilig sein können. Ist er
doch einerseits das wichtigste Instrument das ihm gegeben wird,
anderseits wie ein Schmuckstück das ihm bei der Geburt
umgehangen wird.
| | |
| | | ø \ | | |
Wenn mein Buch je
veröffentlicht wird so muß in seiner Vorrede der Vorrede
Paul Ernst's zu
den Grimmschen
Märchen gedacht werden die ich schon in der
Log. Phil.
Abhandlung als Quelle des Ausdrucks
„Misverstehen der
Sprachlogik” hätte erwähnen
müssen.
| | |
| | | ø \ | | |
Nichts ist so
schwierig Gerechtigk⌊e⌋it gegen die
Tatsachen.
| | |
| | | ø \ | | |
Bild[:|er]⌊:⌋
Die Seele die den Körper verläßt, die in einem
Behältnis aufbewahrt ist, der Tod als Mensch oder der Tod eines
bestimmten Menschen als
ein mit diesem Menschen in irgendeiner Beziehung stehendes
Ding.
| | |
| | | ∫ | | |
Die Welt & der „Untergang der
Welt”.
| | |
| | | ∫ | | |
Die Grammatik des Wortes
„Sprache”.
| | |
| | | ∫ / | | | Nachtr.
Nehmen wir
an:
In den ägyptischen Urkunden wird immer wieder
eine Farbe erwähnt die besonders herrlich sei.
Wir wissen nicht welche es war. Können uns nur aus
Andeutungen denken, daß es ein bestimmtes Braunrot gewesen sein
muß. Eines Tages aber finde[n|t] sich eine
braunrote Platte in besonderer Weise (durch Luftabschluß etc
etc)
konserviert & darunter jener Name der Farbe. Nun
heißt es: jetzt wissen wir, welche Farbe es
war (Und alle Cambridger
Ästheten werden solche Krawatten tragen.)
| | |
| | | / | | | Für uns gibt
es keinen Zusammenhang, der sich beschreiben läßt, sondern nur
den der sich zeigt.
| | |
| | | / | | |
Wie werde ich denn wissen,
daß ich ein Wort 2mal in derselben
Bedeutung gebraucht habe? Kann ich denn die
Bedeutung niederlegen? Oder: nur in sofern ich sie niederlegen kann, kann ich von
ihr reden.
| | |
| | | | | | Was wir
Bedeutung nennen muß mit der primitiven
Gebärden-
(Zeige-)Sprache zusammenhängen.
| | |
| | | | | | In wiefern kann nun diese
hinweisende Erklärung mit den Regeln der Verwendung
collidieren?
| | |
| | | | | | Denn eigentlich dürfen ja Regeln nicht
collidieren, außer sie widersprechen
einander. Denn im Übrigen bestimmen sie ja eine
Bedeutung & sind nicht einer verantwortlich so daß sie ihr
wi[e|d]ersprechen könnten.
| | |
| | | / | | | Wenn [e|E]iner
von einer idealen Sprache redet, so müßte man fragen: in
welcher Beziehung ideal?
| | |
| | | / | | |
Man kann keine Sprache lernen, wenn man
nicht schon eine versteht.
| | |
| | | / | | |
Sprache der Anordnung der Sessel im
Zimmer. Ich kann die Leute die mir auf der Straße
entgegen kommen als Sprache deuten.
| | |
| | | ? / ∫ | | | Ob
[e|E]iner der mir einen deutschen Satz sagt ihn wirklich so
meint, wie ich ihn verstehe ist nur eine Hypothese. Sicher
ist nur, daß ich ihn so deute.
| | |
| | | ? / | | | Aber was heißt
es, ihn so zu deuten? Wie unterscheidet sich diese
Deutung von einer andern? Doch wohl durch die
Erklärung, die ich von ihr geben kann. Wenn ich etwa
sagen „in diesem Sinne wird der Satz von
dieser Tatsache bewahrheitet, in jenem Sinne von
jener”, so habe ich mich durch den Hinweis auf diese
& jene Tatsache wieder eines Zeichens bedient. Am
Schluß also müssen sich die Zeichen
unter-scheiden.
| | |
| | | ∫ | | |
Was heißt es aber überhaupt eine
Tatsache (einen Komplex) deuten,
im Gegensatz dazu, daß man ihn überhaupt nicht als
Zeichen auffaßt?
| | |
| | | | | |
∣ ˇBeispiel: Man muß manchen Satz
öfter lesen um ihn als Satz zu verstehen. ∣
| | |
| | | | | | Kann man denn etwas Anderes als einen Satz
verstehenc?
Oder:
Ist es nicht erst ein Satz, wenn man es versteht.
Also: Kann man etwas anders, als als Satz
verstehen?
| | |
| | | / | | |
Man könnte davon reden
„einen Satz zu erleben”.
Läßt sich dieses Erlebnis nun beschreiben?
| | |
| | | / | | | Wenn ich einen
deutschen Satz höre oder ausspreche, so kommt es ja nicht darauf
an, daß mir das Deutsche wohl bekannt ist & auf die
Geschichte der Bekanntschaft kommt es nicht an. Aber
das Wesentliche des besonderen Erlebnisses ist , ich erlebe eine Tatsache als
Satz.
| | |
| | | / | | |
Da ist es wichtig daß es in einem gewissen Sinne keinen halben
Satz gibt.
| | |
| | | | | | Das heißt vom
halben Satz gilt, was vom Wort gilt, das es nur im Zusammenhang des Satzes
hat.
| | |
| | | | | | Das Verstehen fängt aber erst mit dem Satz
an.
| | |
| | | ? / | | |
Man kann nicht sagen
„dieser Struktur fehlt noch etwas um ein Satz zu
sein”. Sondern es fehlt ihr etwas um
dieser Satz zu sein.
| | |
| | | ∫ ∣ | | |
Beispiel:
Mr
N.N. out – in
|
Wo ist hier übrigens das
Verbum? [M|m]uß man es sich etwa
immer hinzudenken um zu verstehen? Das wäre,
wie wenn jemand glaubte, man brauchte, um eine Richtung
aufzeigen immer einen Pfeil &
⚬ ▶ zeige keine
an, wenn man sich nicht einen Verbindungsstrich zwischen Ring und
Spitze vorstellt.
| | |
| | | / | | |
Den Russen welche statt „er ist
gut” sagen „er gut” geht nichts verloren
& sie denken sich auch kein Verbum dazu.
| | |
| | | / | | | Den kompletten
Satz zu charakterisieren ist so unmöglich, wie die komplette
Tatsache.
| | |
| | | / | | |
Die Philosophie darf den wirklichen
tatsächlichen Gebrauch der Sprache [ … darf,
was wirklich gesagt wird ] in keiner Weise antasten, sie kann
ihn [ es ] am Ende also nur
beschreiben.
| | |
| | | / | | |
Denn sie kann ihn auch nicht
begründen.
| | |
| | | / | | | Sie
läßt auch die Mathematik wie sie ist (jetzt ist)
& keine mathem. Entdeckung
kann sie weiter bringen.
| | |
| | | ∫ | | |
Ein „führendes Problem der mathem. Logik
(Ramsey) ist ein
Problem der Mathematik wie jedes andere.
| | |
| | | ∫ / | | | Wie es
keine Met[h|a]physik gibt, so gibt es keine
Metalogik. Das Wort
„verstehen”, der Ausdruck „einen Satz
verstehen” ist auch nicht metalogisch, sondern ein Ausdruck
wie jeder An andre der
Sprache.
| | |
| | | / | | |
Wie ich oft gesagt habe, führt die
Philosophie nicht zu einem Verzicht, da ich mich nicht
entbreche etwas zu sagen, sondern eine gewisse
Wortverbindung als sinnlos aufgebe. In anderem Sinne
aber erfordert die Philosophie dann eine Resignation, aber des
Gefühls, nicht des Verstandes. Und das ist es
vielleicht, was sie vielen so schwer macht. Es kann schwer
sein, einen Ausdruck nicht zu gebrauchen, wie es schwer ist, die
Tränen zurückzuhalten, oder einen Ausbruch der Wut.
| | |
| | | ∫ | | | Wenn immer
man auf (gleich, oder nach einer gewissen
Überlegung) sagt „of course”
(im Sinne: wie könnte es anders sein) ist mit jener
Behauptung etwas nicht in der Ordnung.
(Wenn es nicht
anders sein könnte so kann es auch nicht so
sein.)
| | |
| | | ∫ | | |
Das Verstehen wird dann wichtig, wenn man es
als eine notwendige Bedingung – etwa – des
Befolgens eines Befehls auffaßt. Der Befehl werde
durch ein Bild der befohlenen Handlung gegeben.
„Ja, aber ich muß dieses Bild auch
verstehen”. – Was heißt das? – „Ich muß wissen, daß ich das tun
”. Aber da
ja das durch das Verstehen des Befehls noch nicht getan ist, so kann
doch dieses Wissen nur darin bestehen, daß ich einer
anderen Tatsache als der der Befolgung habhaft
werde.
| | |
| | | ∫ | | |
Man kann ein Gebilde auf verschiedene verstehen (als Satz auffassen). Diese
Art muß sich in einer Erklärung offenbaren.
| | |
| | | ∫ | | | Ich glaube, wir
würden einen tieferen Einblick gewinnen, wenn wir uns über
die Replik klar würden: „man kann sich nicht
vorstellen, wie es anders sein könnte”
(„What would it be like, if it were
otherwise”).
| | |
| | | / ∫ | | |
„Einen Satz
verstehen heißt: wissen was er
sagt”
| | |
| | | / ∫ | | |
„Die Gebärde
verstehen, heißt wissen was sie bedeutet”
(„wissen, was er meint”)
| | |
| | | / ∫ | | |
Das heißen „wissen daß sie dies
& nicht jenes bedeutet”. Dann aber müßte
dieses Verstehen die Multiplizität eines Satzes haben.
| | |
| | | / | | | Nun ist
die Frage: muß ich wirklich in so einem Sinne das
Zeichen verstehen um etwa danach handeln zu
können? – Wenn jemand sagt:
„gewiß! sonst wüßte ich ja nicht, was ich
zu tun habe”, so würde ich antworten:
„Aber es gibt ja keinen Übergang vom Wissen zum
Tun. Und keine prinzipielle Rechtfertigung
dessen, daß es das war was dem Befehl
entsprach.
| | |
| | | ∫ | | |
Man kann wohl zur Rechtfertigung
sagen: Ich mußte das doch tun; denn Du sagtest
„ …” & wenn man weiter gefragt würde
„aber warum?” müßte man
Worterklärungen von der Art „das ist doch ein
Buch” geben, aber das hieße doch immer nur ein Zeichen
durch ein anderes ersetzen.
| | |
| | | ∫ | | |
Man beachte im vorletzten Satz den Ausdruck
„handeln zu können” & das
Wort „was” in „was ich zu tun
habe”.
| | |
| | | / | | |
Was heißt dann also der Satz:
„Ich muß den Befehl verstehen, ehe ich nach ihm
handeln kann”? Denn hat natürlich einen Sinn. Aber
wieder keinen
metalogischen.
| | |
| | | / | | |
„Aber ich muß doch einen
Befehl verstehen um nach ihm handeln zu
können”. Hier ist das
‚muß’ verdächtig. Wenn das
wirklich ein [m|M]uß ist – ich meine – wenn es
ein logisches Muß ist, so handelt es sich hier um eine grammatische
Anmerkung.
| | |
| | | / | | |
Auch wäre da die Frage
möglich: Wie lange vor dem Befolgen mußt Du denn
den Befehl verstehen?
| | |
| | | / | | |
Wie, wenn man sagt: „ich
kann den Befehl nicht ausführen, wenn ich ihn nicht
deute”? – Das heißt nichts, denn seine
Ausführung ist eine Deutung.
| | |
| | | | | | „Ich kann den Befehl nicht
ausführen, weil ich nicht verstehe, was Du meinst. – Ja, jetzt verstehe ich Dich”.
Was ging da vor, als ich plötzlich den Andern
verstand? Ich konnte mich natürlich irren,
& daß ich den Andern verstand war eine
Hypothese. Aber es fiel mir plötzlich eine
Deutung ein, die mir einleuchtete. Aber war diese Deutung
etwas anderes als ein Satz einer Sprache?
| | |
| | | / | | | Es konnten mir auch vor
diesem Verstehen mehrere Deutungen vorschweben, für deren eine
ich mich endlich entscheide. Aber das Vorschweben
der Deutungen war das Vorschweben von Ausdrücken.
| | |
| | | / | | |
Statt dem Spiel der Vorstellungen
könnten wir immer ein Produzieren physischer Bilder
– etwa mit dem Bleistift auf Papier – annehmen, so daß
keine „private” Sprache entstünde.
| | |
| | | ∫ / | | |
„Leg das Buch auf den Tisch. – Hast Du
mich verstanden?” –
„Ja”.
„Leg das
Buch auf den Abrakadabra. – Hast Du mich
verstanden?” „Nein”. – Nun zeige ich mit erklärender Geste auf den Sessel
& sage dabei „Abrakadabra”.
„Leg das Buch auf den Abrakadabra. –
Hast Du mich jetzt verstanden?”
„Ja”. – Was hat sich denn
verändert? Wir haben ein anderes Zeichen
erhalten.
| | |
| | | / | | |
Wenn ich einen philosophischen Fehler
rektifiziere & sage man hat sich das immer so vorgestellt
aber so ist es nicht,
so muß zeige ich immer auf
eine Analogie zeigen nach der
man sich gerichtet hat, & daß diese Analogie nicht
hält [ so muß ich immer eine Analogie aufzeigen nach
der man gedacht hat die man aber nicht als Analogie erkannt
hat ]
| | |
| | | / | | |
Die Idee ˇdie man von dem Verstehen
hat, ist etwa, daß man dabei von dem Zeichen näher an die
verifizierende Tatsache kommt, etwa durch die
Vorstellung. Und wenn man auch nicht
wesentlich, d.h. logisch, näher kommt, so
ist doch etwas an der Idee
richtig, daß das Verstehen in dem Vorstellen der Tatsache
besteht. Die Sprache der Vorstellung ist in dem gleichen
Sinne wie die Gebärdensprache primitiv.
| | |
| | | / | | | Daher ist auch etwas daran
richtig, daß die Unvorstellbarkeit ein Kriterium der
Unsinnigkeit ist.
| | |
| | | ∫ | | |
Was nennen wir fundamental?
| | |
| | | ∫ | | | Was eine
Naturnotwendigkeit?
| | |
| | | / | | |
Warum empfinden wir die
G Untersuchung der Grammatik als
fundamental?
| | |
| | | / | | |
Das Wort „fundamental”
kann auch nichts metalogisches oder philosophisches Bedeuten,
es überhaupt eine Bedeutung hat.
| | |
| | | ∫ | | | Wir jagen
die Metaphysik aus allen ihren Schlupfwinkeln heraus.
| | |
| | | ∫ | | | Die Untersuchung
der Grammatik ist im selben Sinne fundamental, wie wir die Sprache
fundamental – etwa ihr eigenes Fundament – nennen
können.
| | |
| | | | | |
[G|g]rammati[k|s]che
Untersuchung unterscheidet sich ja von der eines Anglisten
oder Germanisten etc.; uns interessiert
z.B. die Übersetzung von einer Sprache in einer
andre Sprachen. Überhaupt interessieren uns
Regeln die der Philologe gar nicht betrachtet. Diesen
Unterschied können wir also wohl hervorheben.
¥ •
| | |
| | | / | | | „Aber das ist ja
nur ein
äußerer Unterschied
eine äußere Unterscheidung |
”. Ich
glaube, eine andere gibt es nicht.
| | |
| | | / | | | ↺ Anderseits wäre es
irreführend zu sagen, daß wir das Wesentliche der Grammatik
behandeln (er das Zufällige).
| | |
| | | / | | |
Eher könnten wir sagen, daß wir doch etwas anderes
Grammatik nennen als er. Wie wir eben Wortarten
unterscheiden, wo für ihn kein Unterschied
(vorhanden) ist.
| | |
| | | ø | | |
22.6. Wie
irreführend die Erklärungen Frazers sind sieht man – glaube ich – daraus,
daß man primitive Gebräuche sehr wohl selbst erdichten
könnte & es müßte ein Zufall sein wenn sie nicht
irgendwo wirklich gefunden würden. Das heißt das
Prinzip nach welchem diese Gebräuche geordnet sind ist ein
viel allgemeineres als Frazer es erklärt & in unserer
[E|e]igenen Seele vorhanden, so daß wir uns alle
Möglichkeiten selbst ausdenken könnten. –
Daß etwa der König eines Stammes für
nieman-den sichtbar bewahrt wird können wir uns wohl
vorstellen, aber auch daß jeder Mann des Stammes ihn sehen
soll. Das letztere wird dann gewiß nicht in irgend einer
mehr oder weniger zufälligen Weise geschehen dürfen sondern
er wird den Leuten gezeigt werden.
Vielleicht
wird ihn niemand berühren dürfen vielleicht aber jeder
berühren müssen.
Denken wir daran
daß nach Schuberts Tod
sein Bruder Partituren Schuberts in kleine Stücke zerschnitt & seinen
Lieblingsschülern solche Stücke von einigen Takten
schen gab. Diese Handlung als Zeichen
der Pietät ist uns ebenso verständlich wie die
andere die Partituren unberührt niemandem
[Z|z]ugänglich aufzubewahren. Und
hätte Schuberts Bruder
die Partituren verbrannt so wäre auch das als Zeichen der
Pietät mo verständlich.
Das Zeremonielle (heiße oder kalte) im
Gegensatz zum Zufälligen (lauen)
(haphazard) charakterisiert die
Pietät.
Ja
Frazers Erklärungen
wären überhaupt keine Erklärungen wenn sie nicht
letzten Endes an eine Neigung in uns selbst
appellierten.
Das Essen & Trinken ist
mit Gefahren verbunden nicht nur für den Wilden sondern
auch für uns; [N|n]ichts natürlicher als daß
man sich davor vor
schützen will;
& nun könnten wir uns selbst solche
Schutzmaßnahmen ausdenken. – Aber nach
welchem Prinzip
denken erdichten wir sie ⌊(⌋uns aus⌊)⌋?
Offenbar
danach, daß alle Gefahren der Form nach auf einige sehr einfache
reduziert werden die dem Menschen ohne weiteres sichtbar sind.
ˇAlso Nach dem selben Prinzip
nach dem die ungebildeten Leute unter uns sagen
die Krankheit ziehe sich vom Kopf in die Brust etc.
etc.. In diesen einfachen Bildern wird
natürlich die Personification eine
große Rolle spielen, denn daß Menschen (also Geister) dem
Menschen gefährlich werden können ist bekannt.
| | |
| | | ø | | |
Daß der Schatten des
Menschen der wie ein Mensch ausschaut oder sein Spiegelbild, daß
Regen, Gewitter, die Mondphasen, der
Jahreszeitwechsel, die Ähnlichkeit und
[v|V]erschiedenheit der Tiere unter einander & zum
Menschen, die Erscheinungen des Todes, der Geburt & des
Geschlechtslebens, kurz alles was der Mensch jahraus jahrein um sich
wahrnimmt, in mannigfaltigster Weise mit einander verknüpft, in
seinem Denken (seiner Philosophie) & seinen
Gebräuchen eine Rolle
spielen
auftreten |
wird ist selbstverständlich, oder ist eben das was
wir wirklich wissen & interessant ist.
| | |
| | | ø | | | Wie hätte
das Feuer oder die Ähnlichkeit des Feuers mit der Sonne
verfehlen können auf den erwachenden Menschengeist einen
Eindruck zu machen. Aber nicht vielleicht „weil er
sich's nicht erklären kann” (der dumme
Aberglaube unserer Zeit) – denn wird es durch eine
„Erklärung” weniger
Eindrucksvoll? –
| | |
| | | ø | | | Ich meine nicht
daß gerade das Feuer jedem einen Eindruck machen
muß. Das Feuer nicht mehr wie jede andere Erscheinung,
& die eine Erscheinung [d|D]em, die andere
[j|J]enem. Denn keine Erscheinung ist
an sich besonders [G|g]eheimnisvoll aber jede kann es uns
werden & das ist eben das Charakteristische am erwachenden
Geist des Menschen daß ihm eine Erscheinung bedeutend wird.
Man könnte fast sagen der Mensch sei ein zeremonielles
Tier. Das ist wohl teils falsch, teils unsinnig, aber es
ist auch etwas Richtiges daran.
Das heißt
man könnte ein Buch über anthropologie
so anfangen: Wenn man das Leben & Benehmen
der Menschen auf der Erde betrachtet so sieht man daß sie
außer den Handlungen die man tierische nennen könnte der
Nahrungsaufnahme etc
etc etc. auch solche
ausführen die einen ganz Charakter tragen & die man
rituelle Handlungen nennen könnte.
Nun
aber ist es Unsinn so fortzufahren daß man als das
Charakteristische dieser Handlungen sagt sie seien
solche die aus fehlerhaften Anschauungen über die Physik
der Dinge entsprängen (so tut es
Frazer wenn er sagt Magie
sei wesentlich falsche Physik)
bezw.
falsche ,
Technik, etc.)
Vielmehr ist das Charakteristische der
[R|r]ituellen Handlung gar keine Ansicht, Meinung, ob sie
nun richtig oder falsch ist, obgleich eine Meinung – ein Glaube
– selbst auch rituell sein kann, zum Ritus gehören
kann.
| | |
| | | ø | | |
Wenn man es für
selbstverständlich hält daß sich der Mensch an
seiner Phantasie vergnügt so bedenke man daß diese Phantasie
nicht wie ein gemaltes Bild oder ein plastisches Modell ist sondern
ein kompliziertes Gebilde aus heterogenen
Bestandteilen: Wörtern & Bildern.
Man wird dann das Operieren mit Schrift-
& [l|L]autzeichen nicht mehr in Gegensatz stellen
zu dem Operieren mit Phantasi „Vorstellungsbildern” der Ereignisse.
| | |
| | | / | | | Was tut
der, der eine neue Sprache konstruiert (erfindet)? nach welchem Prinzip geht er vor? Denn dieses
Prinzip ist der Begriff ‚Sprache’.
| | |
| | | / | | | Eine Sprache
erfinden heißt nicht auf Grund von Naturgesetzen (oder
in Übereinstimmung
im Einklang |
mit
ihnen) eine Vorrichtung zu einem bestimmten Zweck
erfinden. Wie es etwa die Erfindung des Benzinmotors oder
der Nahmaschine ist. Auch die
Erfindung eines Spiels ist nicht in diesem Sinne eine
Erfindung aber vergleichbar der Erfindung einer Sprache.
| | |
| | | / | | | Ich brauche
nicht zu sagen daß ich nur die Grammatik des Wortes
„Sprache” weiter beschreibe indem ich sie
mit der Grammatik des Wortes „Erfindung” in
Verbindung bringe.
| | |
| | | / | | | Beiläufig gesprochen (ist
der Zusammenhang der Metaphysik mit der Magie
der) hat es der
fr alten Auffassung – etwa der, der
(großen) westlichen Philosophen
– Arten von Problemen ˇim
wissenschaftlichen Sinne gegeben: wesentliche, große,
univers[ä|e]lle, & unwesentliche, quasi
accidentelle Probleme. Und
dagegen ist unsere Auffassung & daneb
daß es kein großes, wesentliches Problem im Sinne der
Wissenschaft gibt.
| | |
| | | / | | |
Eine Sprache erfinden, heißt,
eine Sprache konstruieren. Ihre Regeln
aufstellen. Ihre Grammatik verfassen.
| | |
| | | / | | | Erweitert jede
erfundene Sprache den Begriff der Sprache?
| | |
| | | | | | Was für das Wort „Sprache”
gilt muß auch für den Ausdruck „System von
Regeln” gelten. Also auch für das Wort
„Kalkül”.
| | |
| | | | | | Ist es da übrigens nicht merkwürdig,
daß die Mathematiker immer mit der Feder auf dem Papier
arbeiten?
Und warum z.B. nie mit
kontinuierlichen Farbübergängen?
| | |
| | | | | | Wie bin ich denn zum Begriff
‚Sprache’ gekommen? Doch nur durch die Sprachen die ich
gelernt habe.
Aber haben mich in
gewissem Sinne über sich hinausgeführt, denn ich wäre
jetzt im Stande eine neue Sprache zu konstruieren z.B. Wörter zu erfinden. Also
gehört diese Methode der Konstruktion noch zum Begriff der
Sprache. Aber nur wenn ich ihn so festlege.
| | |
| | | | | | Der
Begriff: sich einander etwas mitteilen. Wenn ich
ˇz.B. sage:
‚Sprache’ werde ich jedes System von Zeichen nennen,
das Menschen untereinander vereinbar[t|en]
haben um
sich miteinander zu verständigen[;| ,] so
konnte man hier schon fragen:
Und was schließt Du unter dem Begriff
‚Zeichen’ ein?
| | |
| | | / | | | Immer wieder hat mein
„u.s.w.” eine
Grenze.
| | |
| | | / | | |
Was nenne ich
„Handlung”, was
„Sinneswahrnehmung”?
| | |
| | | / | | | Die Worte
„Welt”, „Erfahrung”,
„Sprache”, ˇ„Satz”
„Kalkül”, „Mathematik”
können alle nur für triviale Abgrenzungen stehen wie
„[E|e]ssen”,
„ruhen”, etc..
| | |
| | | / | | | Denn wenn auch
ein solches Wort der Tittel unserer Grammatik
wäre – etwa das Wort „Grammatik” – so
hätte doch dieser Tittel nur dieses Buch von andern
Büchern zu unterscheiden.
| | |
| | | / | | | Allgemeine
Ausführungen über
⌊⌊*⌋⌋ die Welt &
die Sprache gibt es nicht.
| | |
| | | ? ∫ / | | | Nachtrag:
Ich
Ich
sage einen Satz „Ich sehe einen schwarzen
Kreis”; aber auf die kommt
es doch nicht an; wir also statt dessen
„a b c d e”. Aber nun kann ich
nicht o[f|h]ne weiteres mit diesen Zeichen den oberen Sinn
verbinden (es sei denn daß ich „a b c d
e” als ein Wort auffasse & dies als Abkürzung
des oberen Satzes). Diese Schwierigkeit ist doch aber
sonderbar. Ich könnte sie so ausdrücken:
Ich bin nicht gewöhnt statt ‚ich’
‚a’ zu sagen & statt
‚sehe’ ‚b’,
statt ‚einen’
‚c’, etc.
etc. |
.
Aber damit meine ich nicht, daß ich, wenn ich daran gewöhnt
wäre, mit dem Wort ‚a’ sofort das Wort
‚ich’ associieren würde;
sondern daß ich nicht gew[ö|o]hnt bin
‚a’ an der Stelle von ‚ich’
zu [G|g]ebrauchen – in der Bedeutung von
‚ich’.
| | |
| | | ? / | | |
Ich halte meine Wange, &
jemand fragt, warum ich es tue & ich antworte:
„Zahnschmerzen”. Das heißt offenbar
dasselbe wie „ich habe Zahnschmerzen”, aber weder
stelle ich mir die fehlenden Worte im Geiste vor, noch gehen sie mir
im Sinne irgendwie
ab. Daher ist es auch möglich daß ich die Worte
„ich habe Zahnschmerzen” in dem Sinne
ausspreche, als sagte ich nur das letzte Wort oder, als wären die
drei nur ein Wort.
| | |
| | | ⁎ | | |
Ist es etwa so, wie Baustein wichtig sein kann, weil er
viel & zu Wichtigem gebraucht wird, und das Wort
ist ein Baustein?
| | |
| | | / | | | Und doch
ist noch etwas , was sich z.B. in der dreifachen Verwendung des Wortes
‚ist’ zeigt. Denn was heißt es, wenn
ich sage, daß im Satz ‚die Rose ist
rot das ‚ist’ eine andere
Bedeutung hat, als in
‚2 × 2
ist 4’? Wenn man sagt es heiße, daß
verschiedene Regeln von diesen beiden Wörtern gelten, so muß
man zunächst sagen, daß wir hier nur ein Wort
haben. Zu sagen aber: von diesem gelten in einem Fall
die Regeln im anderen jene, ist Unsinn.
Und das hängt wieder mit der Frage zusammen, wie
wir uns denn aller Regeln bewußt sind wenn wir ein Wort in einer
bestimmten Bedeutung gebrauchen, & doch die Regeln die
Bedeutung ausmachen?
| | |
| | | / | | |
Es wäre eine Sprache denkbar, in der
die Bedeutung von Worten nach bestimmten Regeln abwechselten,
etwa: Vormittag heißt das Wort A dies, Nachmittag
jenes.
Oder eine Sprache in der die
Wörter sich täglich änderten, indem an jedem Tag jeder
Buchstabe des vorigen Tages durch den nächsten im Alphabet
(& z durch a) ersetzt würde.
| | |
| | | / | | |
23.
Man sagt die Seele verläßt den Körper, um
ihr dann aber jede Ähnlichkeit mit dem Körper zu nehmen
& damit man beileibe nicht denkt es sei irgend ein gasförmiges Ding gemeint sagt man die
Seele ist unkörperlich unräumlich[.|;]
[A|a]ber
mit dem Worte „verläßt” hat man schon
alles gesagt. Zeige mir wie Du das Wort
„seelisch” gebrauchst, & ich werde sehen ob
die See[el|le] „unkörperlich” ist,
& was Du unter
„[g|G]eistig”
verstehst.
| | |
| | | ø | | |
Frazer wäre im Stande zu glauben, daß ein Wilder
aus Irrtum stirbt.
In den Volksschullesebüchern steht,
daß Attila seine großen
Kriegszüge unternommen hat, weil er glaubte, das Schwert des
Donnergottes zu besitzen.
| | |
| | | ø | | | Wir müssen
die ganze Sprache durchpflügen.
| | |
| | | ø | | |
Frazer:
„… That these observances are
dictated by fear of the ghost of the slain seems certain;
…” Aber warum gebraucht denn das
Wort „ghost”? Er versteht
also sehr wohl diesen Aberglauben da er ihn uns mit einem ihm
geläufigen abergläubischen Wort erklärt.
Oder vielmehr, er hätte daraus sehen
können daß auch in uns etwas für jene Handlungsweisen der
Wilden spricht. – Wenn ich, der ich nicht glaube
daß es irgendwo menschlich-übermenschliche Wesen gibt die
man Götter nennen kann – wenn ich sage: „ich
fürchte die Rache der Götter” so zeigt das daß
ich damit etwas meinen (kann) oder einer
Empfindung Ausdruck geben kann die nichts mit jenem Glauben
zu tun hat. [ … , die nicht notwendig mit
diesem jenem Glauben verbunden ist. ]
| | |
| | | / | | | Ich
möchte sagen: nichts zeigt unsere Verwandtschaft mit jenen
Wilden besser als daß Frazer ein ihm & uns so geläufiges Wort wie
„ghost” ˇoder
„shade” bei der Hand hat um die Ansichten
dieser Leute zu beschreiben.
| | |
| | | / | | |
(Denn das ist
etwas anderes als wenn er etwa beschriebe die Wilden bilden
sich ein daß ihnen ihr Kopf herunter fällt wenn sie einen
Feind erschlagen haben. Hier hätte unsere
Beschreibung nichts abergläubisches
oder magisches an sich.)
| | |
| | | / | | | Ja diese
Sonderbarkeit bezieht sich nicht nur auf die Ausdrücke
„ghost” &
„shade” & es wird viel zu wenig
Aufhebens davon gemacht daß wir das Wort
„Seele”, „Geist”
(„Spirit”) zu unserem eigenen
gebildeten vocabular
zählen. Dagegen ist es eine
Kleinigkeit, daß wir nicht glauben daß unsere
Seele ißt & trinkt.
| | |
| | | ø | | |
Frazer ist viel mehr savage als die meisten
seiner savages denn diese werden nicht so weit vom
Verständnis einer geistigen Angelegenheit entfernt sein
wie ein Engländer des 20ten Jahrhunderts.
Seine Erklärungen der primitiven
Gebräuche sind viel roher als der Sinn dieser
Gebräuche selbst.
| | |
| | | / | | |
In unserer Sprache ist eine ganze
Mythologie niedergelegt.
| | |
| | | | | |
Austrei
Austreiben des Todes oder
Umbringen des Todes; aber anderseits wird er als Gerippe
dargestellt, also selbst in gewissem Sinne tot.
„As dead as death”.
‚Nichts ist so tot wie der Tod; nichts so schön wie
die Schönheit selbst. Das Bild worunter man
sich hier die Realität denkt ist, daß die
Schönheit, der Tod, etc. die reine
reinen (conzentrierten) Substanzen
ist sind während sie in einem schönen Gegenstand
ˇnur als Beimischung vorhanden ist
sind. – Und erkenne ich hier nicht meine
eigenen Betrachtungen über Gegenstand &
Complex?
| | |
| | | / | | | Die primitiven Formen
unserer Sprache: Substantiv, Eigenschaftswort &
Tätigkeitswort zeigen das einfache Bild auf
dessen Form sie alles zu bringen sucht.
| | |
| | | ∫ | | | Erdbeeren
suchen & das Gesichtsfeld.
| | |
| | | / | | | Aber wenn so der
allgemeine Begriff der Sprache sozusagen zerfließt,
zerfließt da nicht auch die Philosophie? Nein, denn
ihre Aufgabe ist es nicht eine neue Sprache zu
schaffen sondern die zu reinigen, die vorhanden ist.
| | |
| | | / | | | Nun könnte
man aber sagen: „Du gibst uns [r|R]egeln
für den Gebrauch der Sätze; woran sollen wir aber
erkennen, daß etwas ein Satz ist?”
| | |
| | | / | | |
Nachtrag: Ich hätte nicht sagen sollen
daß sich die Naturnotwendigkeit charakteristisch durch eine in einer
willkürliche Regel ausdrückt.
Sondern: Das Naturnotwendige wird nicht wie das
Notwendige durch einen notwendigen Satz ausgedrückt,
sondern charakteristisch durch eine Regel die einfach
besch beschreibt was ist.
| | |
| | | / | | | Ich
möchte sagen: Es muß die ganze Grammatik als eine
Veranstaltung äußerlicher Regeln genommen werden, mit allen
Regeln für das Ersetzen z.B., & das
Wesentliche nur in der Anwendung eben dieses ganzen Gebildes
werden.
| | |
| | | / | | | Die
gramm. Regel soll z.B. etwas verbieten, etwa daß das Wort
‚A’ an die Stelle des Wortes
‚B’ gesetzt wird. Wie kann sie denn
aber (dann) verbieten, daß das
‚ist’ aus
„2 × 2
= 4” an die Stelle des Wortes
‚ist’ in „die Rose ist rot”
gesetzt wird? Das ist ja Unsinn.
| | |
| | | / | | | Der rührt von der
verderblichen Vorstellung her, als sei hinter dem Wort ein
unsichtbarer Schweif von Regeln, so daß es einen Sinn hätte,
von zwei Worten zu reden die gleich ausschauen.
Es handelt sich um ein Wort, das sich durch zwei
Worte ersetzen läßt die nicht füreinander
eingesetzt werden dürfen.
| | |
| | | / | | |
Denken wir uns die absurde Regel:
Es gibt ein Wort ‚A’ das ich in
f(ξ) als Argument
einsetzen darf & eines das ich nicht einsetzen darf.
| | |
| | | | | | Die Sprache muß
als ganze Institution genommen & betrachtet
werden.
| | |
| | | ø \ | | |
[Die
schlechte Orthographie meiner Jugendjahre bis etwa ins
18te oder 19te hängt mit meinem ganzen
übrigen Charakter (der Schwäche im Lernen) zusammen]
| | |
| | | / | | |
Denken wir uns ein Tagebuch mit Signalen
geführt. Etwa die Seite in Abschnitte für jede
Stunde eingeteilt und nun heißt
‚☓’ ich schlafe,
‚|’ ich stehe
auf, [„|‚]|¯’,
ich schreibe etc..
| | |
| | | ? / | | | Muß denn nicht
die Regel der Sprache – daß also dieses Zeichen das
bedeutet – irgendwo niedergelegt sein?17
| | |
| | | | | |
Muß denn nicht schon, daß
sie niedergelegt werden kann alles besagen?
| | |
| | | / | | | Freilich
auch: Mehr als die Regel niederlegen, kann ich
nicht.
| | |
| | | / | | |
Und warum soll ich, daß
‚☓’ in dieser
Zeile steht, nicht ein Bild dessen nennen, daß ich dann
schlafen gehe? Freilich, daß es die
Multiplizität dessen wiedergeben soll, die in jenen Worten
liegt, kann ich nicht verlangen.
| | |
| | | / | | | Das Schlafengehen war ja
auch nicht dadurch bestimmt.
| | |
| | | / | | |
Wie kann ich denn kontrollieren, daß es
immer dasselbe ist, was ich ‚☓’
nenne. Es sei denn, daß ich etwa ein Erinnerungsbild
zuziehe. Das aber dann zum Zeichen gehört.
| | |
| | | | | | Und wenn ich es nur in
der Signalsprache beschreibe, so weiß ich auch nur, daß
☓ von
|¯
verschieden ist & sonst nichts.
| | |
| | | / | | | Wenn
z.B. Einer fragt: wie weißt Du, daß
Du jetzt dasselbe tust, wie vor einer Stunde & ich
antworte: ich habe mir's ja aufgeschrieben, hier steht
ja ein ‚☓9’!
| | |
| | | / | | | Wenn ich
mich in dieser Sprache ausdrücke, so werde ich
also mit „|¯” immer
dasselbe meinen. Es muß Sinn haben zu sagen, daß ich beide
male dasselbe tue, wenn ich den Befehl
„|¯” befolge
(oder dasselbe getan habe als ich tat was ich durch
„|¯”
bezeichnete)
| | |
| | | ∫ | | |
„Ich meine immer dasselbe
(damit), wenn ich in mein Tagebuch
schreibe ‚es regnet’”. –
„Und zwar was?” Darauf müßte
nun zur Antwort kommen „nun eben daß es
regnet”, oder aber es muß ein anderes Bild
gebraucht werden. Es würde entweder auf
wirklichen Regen gedeutet, oder auf ein gemaltes Bild des Regens, oder
auf eine ‚genauere’ Beschreibung.
| | |
| | | / \ | | |
Daß der Befehl ein Bild
ist heißt (nur) daß aus dem Befehl
hervorgehen muß, was ich zu tun habe.
| | |
| | | / \ | | | Oder sagen
wir so: Es muß aus dem Befehl hervorgehen, soweit es
überhaupt aus etwas hervorgehen kann.
| | |
| | | / \ | | |
(Das ist natürlich alles eine falsche Darstellung.
Man kann nicht sagen aus dem Befehl müsse hervorgehen,
was ich zu tun habe, denn das hieße: aus dem Befehl
muß der Befehl hervorgehen.)
| | |
| | | / \ | | | Nehmen wir
nämlich an, es könnte aus einem Bild klarer hervorgehen,
dann müßte Einer etwas tun können, das zwar dem
Wortbefehl entgegen aber dem Bild, das diesen Befehl – nur
deutlicher – ausdrückt, nicht entgegen wäre.
Das Bild aber müßte aus dem Wortbefehl hervorgehen
können, oder doch ein Vergleich zeigen können, daß
beide das Gleiche befehlen.
| | |
| | | / \ | | |
Die Handlung kann
ebenso durch den Befehl bestimmt
werden, wie sie nachträglich beschrieben werden kann.
D.h. soweit sie überhaupt
beschrieben werden kann; soweit wir
(also) von ihr reden können,
(sie von anderen Handlungen unterscheiden können)
soweit kann sie auch durch die Sprache (den Befehl)
vorausbestimmt werden.
| | |
| | | / \ | | |
(Hier führe ich
natürlich durch die Worte „soweit sie überhaupt etc.” irre. Denn das hieße ja daß man einen
noch erreichbaren Grad der Beschreibung von einem nicht mehr
erreichbaren unterscheiden könnte; daß man von einem
Grade der Beschreibung reden könnte bis zu dem man gelangen
könnte im Gegensatz zu etwas was sich nicht mehr beschreiben
ließe. So als wäre am Schluß die Handlung
natürlich doch nicht ganz beschrieben.)
| | |
| | | / \ | | |
Soweit die Tatsache die Worte der Beschreibung bestimmen
kann, soweit können Worte die Tatsache bestimmen.
| | |
| | | / | | |
I⌊s⌋t [accb
ein Bild von ACCB?
| | |
| | | / | | | Erinnern wir uns
daß auch das gezeichnete Bild ein solches nur durch eine
bestimmte Projectionsart ist.
| | |
| | | / | | | Erinnere
Dich, daß, wenn Du in einem
Projectionssystem etwas
Complexes in etwas Einfaches projizierst, wird
doch die complexe Natur des Projizierten in
der weiteren Anwendung der Projectionsregel zu
Tage treten.
| | |
| | | ∫ | | |
Keine logische Verbindung der Dinge kann der
Sprache entgehen, sobald sie alle Verhältnisses will
beschreiben können.
| | |
| | | / | | |
Wenn man fragt: „ist der
Satz [„|‚]geh aus dem Zimmer’
wirklich ein Bild dieser Handlung”, so kann ich entgegen
fragen: „ist dieser Strich
/ das Bild dieses
Buches?” Und doch kann er das sehr wohl sein, es kommt nur auf die
Projektionsart an. Sie muß sehr kompliziert
sein, wenn der Strich wirklich das Bild des Buches sein soll &
das wird sich woanders zeigen; es werden dann sehr
einfache Verhältnisse sehr komplizierte
Projectionen kriegen.
| | |
| | | ∫ | | | Du mußt Deine
Handlung nach den Worten in einer allgemeinen Art rechtfertigen; d.h. nach den Erklärungen, die Du
nicht im Hinblick auf diesen Fall erhalten hast, sondern zum
Voraus, welcher Fall immer eintreten . Die Erklärung der Sprache durfte
nicht schon einen bestimmten Tatbestand behaupten oder voraussetzen,
sondern mußte, was tatsächlich der Fall ist
offenlassen.
| | |
| | | ∫ | | |
„Ich komme weil Du geläutet
hast”
| | |
| | | / | | |
Wie unterscheidet sich denn blau von
rot?
| | |
| | | / | | |
Wir meinen doch nicht, daß das eine
die, das andere jene Eigenschaften hat. Übrigens sind
Eigenschaften von Blau & Rot, daß dieser Körper
(oder Ort) blau, jener rot ist.
| | |
| | | | | |
24. Nachtrag &
Bemerkungen dazu:
Auf die Frage
„welcher Unterschied ist denn zwischen blau und rot”
möchte man antworten: das eine ist blau das andre
rot. Aber das heißt natürlich nichts & man
denkt hier in Wirklichkeit an den Unterschied der Flächen oder
Örter, die diese Farbe haben. Sonst
nämlich hat die Frage überhaupt keinen
Sinn.
| | |
| | | / | | |
Was ich sage heißt also: Rot kann man nicht
beschreiben. Aber kann man es denn nicht malerisch
darstellen, indem man etwas rot malt?
| | |
| | | / | | | Nein, das ist keine
malerische Darstellung der Bedeutung des Wortes
‚rot’ (die gibt es nicht).
⌊Das Porträt von rot.⌋
| | |
| | | / | | | Aber jedenfalls
ist es doch nicht Zufall, daß man zur Erklärung der
Bedeutung des Wortes ‚rot’
auf einen roten Gegenstand zeigt!
| | |
| | | / | | | (Was
daran natürlich ist, ist in diesem Satze dargestellt durch das
zweimalige Vorkommen des Wortes
‚rot’)
| | |
| | | / | | | In wiefern hilft die
hinweisende Erklärung „das ist
‚rot’” zum Verständnis des
Wortes?
| | |
| | | / ∫ | | |
(Sie
‚hilft’ gar nicht, sondern ist
eben eine der symbolischen Regeln für den Gebrauch des Wortes
‚rot’.)
| | |
| | | ∫ | | |
In welchem Falle sagen wir, daß zwei
Menschen einem Wort die gleiche Bedeutung geben? Wie ist
die Bedeutung denn fixiert? Doch nur durch
Erklärungen der Sprache selbst: d.h.
Beschreibungen der Sprache.
| | |
| | | ∫ | | |
[Mein Buch
heißen: Eine Philosophische
Betrachtung. (Als Haupt-, nicht als
Untertittel)]
| | |
| | | / | | | Muß es nicht
so sein, wenn ich recht habe: Aus der
Beschreibung der Sprache muß hervorgehen, welche Bedeutung
jedes Wort hat?
| | |
| | | / | | |
(Und hier ist „wenn ich recht habe” unrichtig; denn
wenn ich wirklich Philosophie betreibe darf ich nicht recht haben
müssen. Denn erst wenn ich nur das
Selbstverständliche sage ist es Philosophie.)
| | |
| | | ∫ / | | |
D.h. das Bild des Bildes muß selbst
ein Bild der ersten
Art
im ersten Sinn |
sein. [ D.h.:
das Bild des Bildes der Welt muß selbst ein Bild der Welt
sein ]
| | |
| | | / | | |
D.h.
Das Bild des Bildes muß das
erste dieses ersetzen können.
| | |
| | | / | | | Wenn die Beschreibung der
Sprache zugleich ihre Bedeutung gibt, dann kann man die Sprache ein
Bild der Welt nennen.
| | |
| | | / | | | ⌊
Die Beschreibung der Sprache muß
dasselbe leisten wie die Sprache ⌋
| | |
| | | / | | | Denn dann kann
ich wirklich aus dem Satz, der Beschreibung, ersehen, wie es sich in
der Wirklichkeit verhält.
| | |
| | | / | | | (Aber nur das
nennt man ja „Beschreibung” & nur das
nennt man ja
„ersehen wie es sich verhält”!)
| | |
| | | / | | | (Und
etwas anderes ist es ja nicht, was wir alle ˇdamit
sagen[,| :] wenn daß wir aus
der Beschreibung ersehen, wie es sich in Wirklichkeit
verhält.)
| | |
| | | / | | |
Angenommen wir lassen die Übersetzung
in die Gebärdensprache fort; zeigt es sich dann in der Anwendung
(ich meine, in den grammatischen Regeln der Anwendung) daß
diese Übersetzung möglich ist?
| | |
| | | / | | | *Und
kann es sich nur zeigen, daß sie möglich ist, oder
auch, daß sie notwendig ist?
¥ [Siehe nächste
Seite]
| | |
| | | / | | |
Aber wie könnte das sein? denn dann wären ja die hinweisenden
Erklärungen überflüssig; das heißt aber schon
implicite in den andern
enthalten. Wie kann denn eine Regel eines Spiels
überflüssig sein wenn es eben das
Spiel sein soll was auch durch diese Regel charakterisiert
wird.
| | |
| | | | | | Fehler besteht hier immer wieder darin daß ich
vergesse daß erst alle Regeln das Spiel, die Sprache
characterisieren &
das diese Regeln nicht einer Wirklichkeit
verantwortlich sind, so daß sie von ihr kontrolliert
würden & so daß man von einer Regel bezweifeln
könnte daß sie
notwendig oder richtig wäre. (Vergleiche das
Problem der Widerspruchsfreiheit der
Nicht-Euklidischen
Geometrie!)
| | |
| | | / | | |
Die Grammatik ist keiner
Wirklichkeit verantwortlich.
| | |
| | | / | | | (Die Grammatik ist der
Wirklichkeit nicht Rechenschaft schuldig)
| | |
| | | / | | |
⍈ [Anschließend
an den Satz *] Wenn sie notwendig ist,
so heißt das, daß die Sprache vermittels des roten
Täfelchens in irgend einem Sinn
notwendig ist; & nicht gleichberechtigt der
Wortsprache.
| | |
| | | / | | |
Ich kann ein helles Rot
‚A’ nennen & ein dunkles
‚B’, aber es wird sich in der Grammatik dieser
Wörter zeigen, daß sie in dem Sinne Verwandtes bedeuten wie
eben hellrot & dunkelrot verwandt sind. Es
wird z.B. gesagt werden können, daß die
Farbe eines Flecks A ist & dann immer dunkler
wird, bis sie B ist.
| | |
| | | / | | |
(Ein Gleichnis gehört zu unserem
Gebäude; aber wir können auch aus ihm keine Folgen
ziehen, es führt uns nicht über sich selbst hinaus sondern
muß als Gleichnis stehen [B|b]leiben.
Wir können keine Folgerungen daraus ziehen. So,
wenn wir den Satz mit einem Bild vergleichen & die
(wobei ja, was wir unter ‚Bild’ verstehen
ja schon in uns
festliegen muß) oder wenn ich die Anwendung der Sprache mit der, etwa, des
Multiplicationskaküls
vergleiche.
Die Philosophie
stellt eben alles bloß hin & erklärt & folgert
nichts.)
| | |
| | | / | | |
Woher aber die Sicherheit, daß es sich
zeigen muß? Da fehlt mir ein
Ausdruck.
| | |
| | | / | | |
Denn nur was sich in der Anwendung
zeigt ist ja die Bedeutung! Anderseits: Wenn
man sagt „es muß sich in der Anwendung zeigen, daß das
Wort diese Bedeutung hat”, ist das
irreführend. Welche Bedeutung denn? – Und der Ausdruck, der diese Frage
beantwortet [ der darauf antwortet ] enthält die Anwendung
muß die
Anwendung enthalten |
,
um die die Bedeutung zeigt.
| | |
| | | ? / | | | Die
Erklärung der Wortbedeutung ist
Erklärung der Anwenwendung des Wortes.
| | |
| | | / | | | Zu sagen,
daß das Wort
„[R|r]ot”
mit allen Vorschriften die von ihm gelten, das bedeuten könnte was
tatsächlich das Wort „blau” bedeutet;
daß also durch diese Regeln die Bedeutung nicht fixiert ist, hat
nur einen Sinn, wenn ich die beiden Möglichkeiten der Bedeutung
ausdrücken kann & dann sagen, welche die von mir
bestimmte ist.
| | |
| | | / | | |
(Diese letztere Aussage ist aber
eben die Regel die vorher zur Eindeutigkeit gefehlt
hat.)
| | |
| | | | | | Wie, wenn eine
Sprache aus lauter einfachen & unabhängigen Signalen
bestünde?! Denken wir uns diesen Fall:
Es handle sich etwa um die Beschreibung einer Fläche, auf
der in schwarz und weiß sich allerlei Figuren zeigen
können. Wäre es nun möglich, alle
möglichen Figuren durch unabhängige Symbole zu
?
Wenn ich recht habe, so muß die (Ich nehme
dabei an daß ich nur über, sagen wir, 100000 Figuren
reden will) Wenn ich recht habe, so
muß die ganze Geometrie in den Regeln über die Verwendung
dieser 100000 Signale wiederkehren. (Und zwar
ebenso wie die Arithmetik, wenn wir statt 10
unabhängiger Zahlzeichen eine Bilion
verwendeten.)
| | |
| | | / | | |
Um eine Abhängigkeit
auszudrücken, bedarf es einer Abhängigkeit.
| | |
| | | ? / | | | Wenn man
sagt: es muß sich doch in der Regel für die
Anwendung zweier Worte zeigen wenn sie Dinge bezeichnen die eine
innere Verwandtschaft haben so macht man hier den Fehler zu vergessen
daß ich ja von dieser Verwandtschaft der Bedeutungen nur reden kann
wenn sie sich in der Erklärung ⌊–⌋ etwa der
hinweisenden – der Bedeutung zeigt. Wenn ich
also etwa sage „‚A’ bedeutet
diese Farbe”, ‚B’
diese”, so habe ich, welche Verwandtschaft immer in
den Bedeutungen , in die
Erklärung gelegt.
| | |
| | | ∫ | | |
„Für mich
aber doch jetzt
‚rot’ & ‚blau’ eine ganz
bestimmte Bedeutung”. Wohl, ich bezeuge mir das,
indem ich mir bei ‚blau’ etwas vorstelle &
bei ‚rot’ etwas. Aber damit
übersetze ich schon die Wortsprache in eine andere.
Die Grammatik der Wortsprache hat nichts andres zu tun, als die
beiden Zeichen verschieden zu machen. Denn etwas anderes
k[ö|o]nnten
wir nicht sagen, als da[s|ß] blau und rot verschieden
sind.
| | |
| | | ∫ | | |
Einwand: „Wenn ich nur die Worte
hätte, könnte ich mir einmal das, einmal jenes
vorstellen”. Aber was ist das
Criterium dafür daß mir
ˇimmer das gleiche vorstelle, oder daß es einmal das,
einmal jenes ist?
| | |
| | | ∫ | | |
Ich sagte „etwas anderes
k[ö|o]nnten
wir nicht sagen, als daß blau & rot verschieden
sind”. Aber dies ist doch nur in der gramm. Regel
an niedergelegt ausgedrückt gesagt
daß beiden Worte nicht für einander
eingesetzt werden dürfen. Was in anderen gramm. Regeln gesagt ist,
ist in dieser nicht gesagt. Und es gibt
noch andere die von diesen den
W[ö|o]rten ‚blau’ &
‚rot’ handeln (z.B. auch
die hinweisenden Regeln „das ist
blau” & „das ist rot”
in [u|U]bereinstimmung mit
welchen ich mir auch jene Vorstellungen aufgerufen
habe) Und
[d|D]as
Wesentliche ist nur Was ich sagen will ist
nur, daß man nicht sagen kann daß die Bedeutung
dieser Worte mit den hervorgerufenen Vorstellungen kommt &
vergeht, daß diese Vorstellungen die
Bedeutungen ist sind. Und daß, soweit sie eine Vorstellung
beze Bedeutung bezeugen, in
Übereinstimmung mit eben den Regeln
sein müssen, die die Bedeutung festlegen. [ … in denen die Bedeutung festgelegt
ist. ]
| | |
| | | ∫ | | |
Die Bedeutung muß von vornherein angebbar
sein.
| | |
| | | ∫ | | |
Ein Wort kann eine Farbe bedeuten, aber auch einen
farbigen Fleck. Das he⌊i⌋ßt aber nicht daß
dieser Fleck die Bedeutung des Wortes ist. Daß ich also
etwa von der Bedeutung des Wortes sagen kann sie stehe links von
einem anderen Fleck oder sie verschwinde etc. Es
wäre also wohl weniger
mißverständlich
besser |
im ersten Satz statt
‚bedeuten’ ‚bezeichnen’ zu
sagen.
| | |
| | | ∫ | | |
Der Satz der Tatsache ähnlich!
Ähnlichkeit eines geometrischen Gebildes
seiner
Projection. Offenbare & nicht
offenbare Ahnlichkeit.
Projection von
2 + 3 in
5.
Vorstellung scheinbar auf anderer Stufe wie
ein andres Bild.
Beschreibung der Vorstellung
ähnlich der Beschreibung der Tatsache. Aber auch
Beschreibung des Satzes ähnlich der Beschreibung der
Tatsache, wenn wir namlich das ganze
Projectionssystem beschreiben.
Das Zeichen mit seiner Grammatik ist erst, was
diese Befolgung rechtfertigt, & daher, dessen
Beschreibung die Beschreibung der Tatsache
ˇ(Befolgung) enthält.
Der Satz ist der Tatsache so ähnlich wie
„5” dem Ausdruck
2 + 3.
| | |
| | | / | | | Die Anwendung
der Sprache geht über diese hinaus, aber nicht die
Deutung. Die Deutung vollzieht sich noch im Allgemeinen,
als Vorbereitung auf jede Anwendung. Sie geht in der
Sprachlehre vor sich & nicht im Gebrauch der
Sprache.
| | |
| | | ø | | |
Es ist
schwer sich an kein Gleichnis zu verlieren.
| | |
| | | ∫ / | | | Kann man
also sagen: Es genügt vollkommen, wenn die
Philosophie ihre Bemerkungen über den Ausdruck in
der deutschen Sprache macht, über die Sprache des Chemikers etc?
D.h., die Philosophie macht ihre
Bemerkungen
über Sprachen den Ausdruck in
verschiedenen Sprachen nicht über einen diesen
ubergeordneten Begriff.
| | |
| | | / | | | Wir reden von den
räumlichen & zeitlichen Phänomen der
Sprache. Nicht von einem unräumlichen &
unzeitlichen Unding. Aber wir reden von ihr so, wie von den
Figuren des Schachspiels, indem wir Regeln für sie tabulieren,
nicht ihre physikalischen Eigenschaften beschreiben.
| | |
| | | ∫ | | | Der
Dogmatismus in der Philosophie besteht darin
entsteht dadurch |
daß Behauptungen gemacht werden, die nicht
von jedem anerkannte grammatische Regeln seiner Sprache
seines
Ausdrucks |
sind. Es wird so
wieder der Anschein erweckt als müßten wir in der
Philosophie konstruieren & neue Entdeckungen machen,
Zusammenhänge .
| | |
| | | ∫ | | | In der Logik scheinen wir es
mit
‚allen Sätzen’ zu tun zu
haben. Aber wir konstruieren nur einen Kalkül
& überlassen die Anwendung sich selbst.
| | |
| | | ∫ | | | Wir arbeiten in
der Philosophie mit Sprachen
⌊⋎⌋? eben denen die wir
◇◇◇ verwenden, denn die Regeln ihrer Verwendung
wir ja feststellen.
| | |
| | | ∫ | | | Wir arbeiten in
der Philosophie mit Sprachen, den alltäglichen
Gebilden ‒ ‒ ‒
| | |
| | | / | | |
Wir können in der Philosophie
ˇauch keine größere
Allgemeinheit erreichen, als in dem was wir in Leben und
Wissenschaft .
(D.h. auch hier lassen wir alles wie es
ist.)
| | |
| | | / | | |
So ist eine aufsehenerregende
Definition der Zahl Sache der
Philosophie.
| | |
| | | / | | |
Die Philosophie hat es mit den
bestehenden Sprachen zu tun & nicht vorzugeben, daß sie von einer
abstrakten Sprache handeln müsse.
| | |
| | | / | | |
25.
Nachtrag etc.: Ich kann
mich doch offenbar von der Farbe führen lassen & zwar,
wie ich mich durch Worte nicht führen lassen kann, weil
ich nicht für alle Schattierungen Worte
habe.
| | |
| | | ∫ | | |
Die Bedeutung – etwa – des Wortes
„Sessel” ist vielfach verankert.
| | |
| | | ? / | | | Was immer
[b|B]eiläufiges beim Aussprechen des Satzes vor sich
geht, ich muß mich dann nach ihm richten können.
Und dabei wird sich die Bedeutung der Wörter zeigen; aber
nicht so, als ob sie nun erst in der Handlung zum Vorschein
käme. Denn sie kommt ja nur bei der Handlung zum
Vorschein die dem Satz entspricht. Und ob sie ihm
entspricht, kann ja nur auf Grund der
Bedeutung der Wörter entschieden werden. Sondern bei
der Entscheidung ob die Handlung dem Satz
entspricht, zeigt sich die Wortbedeutung.
D.h. beim Collationieren
der Tatsache gegen den Satz zeigt sich die
Bedeutung. ¥
* Nächste Seite
| | |
| | | / | | | Soweit die
Bedeutung der Wörter in der Tatsache (Handlung) zum
Vorschein kommt, kommt sie ˇschon in der Beschreibung
der Tatsache zum Vorschein. (Sie wird also ganz in der
Sprache bestimmt.)
In dem, was sich hat
voraussehen lassen; worüber man schon vor dem
Eintreffen der Tatsache reden konnte.)
| | |
| | | | | | „Bedeutung”
kommt von „deuten”.
| | |
| | | / | | |
⍈↺ *
Aber dieses
Collationieren ist eben unabhängig davon ob
der Satz stimmt oder nicht.
| | |
| | | / | | | Nun
ist aber dieses Collationieren, wie auch der Begriff
der Bedeutung ein Überbleibsel einer primitiven
Anschauung.
| | |
| | | / | | |
Wenn ich etwa die wirkliche
Sitzordnung an einer Tafel nach einer Aufschreibung
[C|c]ollationiere, so hat es einen
guten Sinn beim Lesen jedes Namens
bei jedem Namen |
auf einen bestimmten Menschen zu zeigen. Sollte ich aber
etwa die Beschreibung eines Bildes mit dem Bild vergleichen &
außer dem Personenverzeichnis sagte die Beschreibung auch daß
A den B küßt, so wüßte ich nicht, worauf
ich, als Korrelat des Wortes ‚küssen’ zeigen
sollte. Oder, wenn etwa stünde „A ist
größer als B”, worauf soll ich beim Wort
‚größer’ zeigen? – Ganz
offenbar kann ich ja gar nicht auf etwas diesem Worten
entsprechendes in dem Sinne zeigen, wie ich etwa
auf die Person A im Bild zeige.
| | |
| | | / | | | Das Wort
„ein gewisser” & seine
Grammatik. Ein Beispiel wie man Worte häuft um
eine Bedeutung zu sichern statt auf die Spielregeln zu achten.
(Als wollte man dem Schachkönig ein wirkliches Gesicht
anmalen um ihm die
richtige Wirkung zu sichern.)
| | |
| | | | | | Es gibt freilich einen Akt „die
Aufmerksamkeit auf die Größe der Personen
richten” oder auf ihre Tätigkeit & in diesem
Sinn kann man auch das Küssen & die
Größenverhältnisse
collationieren. Das zeigt wie der
allgemeine Begriff der Bedeutung entstehen konnte. Es
geschieht da etwas analoges wie wenn
das Pigment an Stelle der Farbe tritt.
| | |
| | | ∫ | | | Der Satz, das Wort
habe nur im Satzverband [b|B]edeutung, muß
natürlich auch, correct
gefaßt, ganz anders lauten. (Natürlich als Regel
der Sprache)
| | |
| | | ø | | |
Die historische Erklärung,
die Erklärung als eine Hypothese der Entwicklung ist
nur eine Art der Zusammenfassung der Daten –
ihrer Synopsis. Es ist ebensowohl möglich die Daten in
ihrer Beziehung zu einander zu sehen & in ein
allgemeines Bild zusammenzufassen ohne es in
Form einer Hypothese über die zeitliche Entwicklung zu
.
| | |
| | | ø | | |
Identifizierung der
eigenen Götter mit Göttern andrer Völker.
Die Namen Man überzeugt sich davon daß
die Namen die gleiche Bedeutung haben.
| | |
| | | / | | | Die
deutsche, & jede, Sprache legt nicht nur
Sprachformen fest sondern sagt auch was sie bedeuten sollen, fixiert ihre
Bedeutung.
| | |
| | | / | | |
29.6. Was ein Satz ist,
wird durch die Grammatik bestimmt.
D.h. innerhalb der Grammatik.
(Dahin zielte auch meine
„allgemeine Satzform”)
| | |
| | | ø \ | | |
(Struktur und Gefühl in der Musik. Die
Gefühle begleiten das Auffassen eines Musikstücks wie
sie die Vorgänge des Lebens begleiten.)
| | |
| | | ∫ | | | [Die
liebliche Temperaturdifferenz der Teile eines menschlichen
Körpers]
| | |
| | | / | | | „Ich kann das
Wort ‚gelb’ anwenden” – ist das auf
einer anderen Stufe als „ich kann [s|S]chach
spielen”, oder „ich kann den König im
Schachspiel verwenden”?
| | |
| | | | | | Denken wir wieder an die Intention, Schach zu
spielen. Ich setze mich hin & sage „nun
wollen wir Schach spielen”. In gewissem Sinne habe
ich mir damit vorgenommen, die Regeln des Schachspiels zu
befolgen. Aber habe ich diese Regeln alle an mir
vorbei passieren lassen?
Nein. – Ich habe z.B. nicht
an die Regel des Rochierens gedacht. Nun kommt es aber zum
Rochieren. Warum erkenne ich diese Regel als eine
Regel des Schachspiels an? Weil sie im Schachbuch
steht? Nein. Ich könnte mir ja
denken, daß sie, wenn ich nachsehen will, in keinem Buch
steht. Weil ich sie mir vorgesetzt hatte?
Nein, denn ich hatte nicht an sie gedacht. Es wird also auf andere
Weise entschieden, ob eine Regel zum Schachspiel gehört, ob ich
also meinem Vorsatz gefolgt bin oder nicht.
| | |
| | | / | | | In der Grammatik des
Wortes „Schach” stehen auch die
Schachregeln.
| | |
| | | / | | |
Wenn ich nun sage: das
Schachspiel besteht in den Regeln: wo sind denn
diese Regeln vorhanden. Ich erkenne ja die Autorität
der Schachbücher nicht an, da ich es für
möglich halte, daß sie nicht die Regeln
enthalten, die ich meine.
Und mein Vorsatz
wird ein Anderer, wenn ich mir vornehme,
die Regeln zu befolgen, welche immer es seien mögen,
die ich in einem bestimmten Buche finde.
| | |
| | | | | | Kann man nun etwa sagen; mein Vorsatz sei der, zu tun,
was ich an einer bestimmten Stelle meines Gedächtnisses
finde?
| | |
| | | | | | Das heißt, es
wird im Vorsatz ein bestimmtes Criterium
gegeben, wonach dann entschieden wird, ob etwas einer
Schachregel gemäß ist. (Quasi der
Begriff der Schachregel)
| | |
| | | | | | Wenn ich daher sage, ich verstehe das
Wort „gelb”, so werde ich auch erst
später entscheiden, ob diese Verwendung der
ursprünglichen Bedeutung gemäß ist, oder nicht.
Denn nach einem
Regelverzeichnis kann ich mich auch hier nicht richten.
Denn wer weiß, was ich darin finde.
| | |
| | | | | | Ich kann nichts tun, als Regeln in einem
Buche niederlegen.
| | |
| | | | | |
Und das zeigt das Verhältnis, welches meine Tätigkeit zum
Unmittelbaren hat.
| | |
| | | | | |
Wenn ich z.B. sage, von der
Verneinung gelten diese Regeln, so darf es keinen Sinn haben zu
fragen: Woher weißt Du, daß Du noch immer vom Selben
(der Verneinung im selben Sinne) sprichst.
Denn in diesem Sinne
constituieren die Regeln die Verneinung,
wie die Schachregeln das Schach.
| | |
| | | | | | Wenn ich von ‚der Bedeutung’ des
Wortes „Schach” (oder
„[G|g]elb”) rede, statt das Wort
(blos) zu
gebrauchen, so setze ich dabei eine Regelverzeichnis
voraus.
Wenn ich ein Buch über Sprache schreibe so muß das die Regeln
enthalten oder in andere Bücher eingreifen, die enthalten. (Ich meine
„eingreifen” wie ein Zahnrad ins
andere.)
| | |
| | | | | | Über die
Sprache sind nicht mehr Skruppeln berechtigt als
über das ein Schachspieler über das
Schachspiel hat, namlich
keine.
| | |
| | | | | | Kann man eine
Intention haben, ohne sie auszudrücken? Kann man
die Absicht haben Schach
zu spielen (in dem Sinne, in welchem man ˇapodiktisch sagt
„ich hatte die Absicht Schach zu spielen; ich muß es
doch wissen”.) ohne einen Ausdruck
dieser Absicht? – Könnte man da nicht
fragen: Woher weißt Du, daß das, was Du hattest,
diese Absicht war?
Ist die
Absicht Schach zu spielen etwa, wie die Vorliebe für
das Spiel (oder für eine Person.
Wo man auch fragen könnte: Hast Du diese
Vorliebe die ganze Zeit oder etc. & die
Antwort ist, daß „eine Vorliebe haben” gewisse
Handlungen, Gedanken & Gefühle einschließt
& andere ausschließt.
| | |
| | | / | | | Muß ich nicht
sagen: „Ich weiß, daß ich die Absicht
hatte, denn ich habe mir gedacht „jetzt
komme ich endlich zum Schachspielen” oder etc. etc.
| | |
| | | / | | | Es würde sich mit der
Absicht in diesem Sinne auch vollkommen vertragen,
ich beim ersten Zug darauf käme,
daß ich alle Schachregeln vergessen habe, & zwar so, daß
ich nicht etwa sagen könnte „ja, als ich den Vorsatz
, da ich sie
noch gewußt”.
| | |
| | | / | | | Es wäre wichtig, den
Fehler allgemein auszudrücken, den ich in allen diesen
Betrachtungen zu machen .
Die falsche Analogie aus der er entspringt.
| | |
| | | / | | | Eine der
wichtigsten Aufgaben ist es ja, alle falschen Gedankengänge
so charakteristisch
auszudrücken, daß der Leser sagt „ja, genau so habe
ich es gemeint”. Die Physiognomie jedes
Irrtums nachzuzeichnen.
| | |
| | | / | | | Wir können
ja auch nur dann den Andern eines Fehlers überführen,
wenn er anerkennt, daß dies
(wirklichc) der Ausdruck
seines Gefühls ist. [ … wenn er diesen
Ausdruck (wirklich) als den richtigen
Ausdruck seines Gefühls anerkennt. ]
| | |
| | | / | | | Nämlich,
nur, wenn er ihn als solchen anerkennt, ist er der richtige
Ausdruck. (Psychoanalyse)
| | |
| | | | | | Ich glaube, jener Fehler liegt in der
Idee, daß die Bedeutung eines Wortes eine Vorstellung ist,
die das Wort begleitet.
Und diese
Conzeption hat steht wieder mit der
des Bewußt[s|-S]eins zu tun in
Verbindung.
Dessen, was ich immer „das Primäre”
nannte.
| | |
| | | / | | |
Wenn ich namlich
über die Sprache – Wort, Satz etc. –
rede, muß ich die Sprache des Alltags reden. –
Aber gibt es denn eine andere?
| | |
| | | / | | | Ist diese Sprache etwa zu
grob, materiell für das, was wir sagen wollen?
Und kann es eine andere geben? Und wie
merkwürdig, daß wir dann mit der unseren etwas anfangen können.
| | |
| | | / | | | Es ist doch
klar, daß jede Sprache die dasselbe leistet, dieselbe sein
müßte[!| .] Daß also unsere
gewöhnliche nicht schlechter ist, als irgend eine andere.
| | |
| | | / | | | Daß ich
beim Erklären der Sprache (in unserem Sinne) schon die
volle Sprache (nicht etwa eine vorbereitende, vorläufige,
anwenden muß, zeigt schon, daß ich nur Äußerliches
über die Sprache kann.
| | |
| | | / | | | Ja, aber
wie können uns diese Ausführungen dann
befriedigen? – Nun, Deine Fragen waren ja auch schon
in dieser Sprache abgefaßt;” mußten in
dieser Sprache ausgedrückt werden, wenn etwas zu fragen
war!
| | |
| | | / | | |
Und deine Skrupel sind
Misverständnisse.
| | |
| | | / | | | Deine
Fragen beziehen sich auf Wörter, so muß ich von Wörtern
reden.
| | |
| | | ø | | | (Der Ernst
Labors ist ein sehr später
Ernst.)
| | |
| | | | | |
Man sagt: Es kann kommt doch nicht
auf's auf das Wort ankommen, sondern auf
seine Bedeutung & denkt dabei immer an die Bedeutung als ob
sie nun eine Sache von der Art des Worts wäre,
allerdings vom Wort verschieden. Hier ist das Wort, hier
die Bedeutung. (Das Geld, & die Kuh die man
dafür kaufen kann. Anderseits aber: das Geld,
& ◇◇◇ sein Nutzen.)
| | |
| | | ∫ | | | In der fertigen Grammatik
des Wortes „Schach” müssen allerdings
alle Schachregeln ;
d.h. im Laufe der Verwendung dieses
Wortes werden die Regeln auftreten können.
– –
| | |
| | | / | | |
Was
anerkennt, ist die Analogie die ich ihm darbiete, als Quelle seines
Gedankens.
| | |
| | | ∫ | | |
„Ich wünsche mir schon lange
…” Worin besteht das Wünschen & wie
verhält es sich zu seinem sprachlichen Ausdruck?
| | |
| | | / | | | Wenn ich
sagte in die Grammatik des Wortes „Schach”
treten die Regeln des Spiels ein, so hätte ich statt dessen auch
sagen konnen: das Wort
„Schach” wird mit Hilfe der Regeln
definiert. Seine Bedeutung durch diese Regeln
erklärt.
| | |
| | | ø \ | | |
(Der Stil
meiner Sätze hat – glaube ich – oft den Fehler eines
schlechten musikalischen Satzes. Man glaubt diese
Stimme klar zu hören, spielt man sie aber, so
fällt sie heraus [ so sticht sie unangenehm
hervor ] weil diese Töne anders untergebracht
gehörten.)
| | |
| | | / | | |
Für den der die Spielregeln vergessen
hat, kann aber das Schach nicht auf diese Weise definiert
sein, sondern, etwa, als das Brettspiel mit diesen
Figuren⌊.⌋ etc. ⌊–⌋ Aber ist
das wahr? E[s|r] wird doch, wenn ich ihm die
Regeln in Erinnerung bringe, sie als die Regeln des Spiels anerkennen
das er gemeint hat.
| | |
| | | / | | | Der
Spieler der die Intention hatte Schach zu spielen hatte sie schon
dadurch daß er ˇzu sich etwa die Worte sagte
„jetzt wollen wir Schach spielen”.
Ich will sagen daß das Wort
„Schach” eben auch
(nur) ein in einem Kalkül
ist. Wird der Kalkül beschrieben so müssen wir
die Regeln tabulieren [ tabuliert vor uns
haben ] , wird er aber angewandt, so wird jetzt gemäß
der einen, dann gemäß der andern Regel
vorgegangen, dabei kann uns ihr
[a|A]usdruck vorschweben, oder auch nicht.
| | |
| | | / | | | Muß denn dem,
der das Wort „Schach” gebraucht eine
Definition des Wortes vorschweben? Gewiß
nicht. – Gefragt was er unter
„Schach” versteht, wird er erst eine geben.
Diese Definition ist selber ein bestimmter Schritt in
seinem Kalkül.
| | |
| | | | | |
Wenn ich ihn aber nun fragte: Wie Du das Wort
ausgesprochen hast, was hast Du da damit gemeint? Wenn er
mir darauf antwortet: „ich habe das Spiel
gemeint das wir so oft gespielt haben etc
etc”, so weiß ich daß ihm
diese Erklärung in keiner Weise beim Gebrauch des Worts
vorgeschwebt hatte & daß seine Antwort meine Frage nicht in
dem Sinne beantwortet daß sie mir sagt was quasi
„in ihm ”
als er dieses Wort sagte.
| | |
| | | / | | |
Denn die Frage ist eben ob
unter der „Bedeutung in der man ein Wort
gebraucht” ein Vorgang verstanden werden soll den wir beim
[s|S]prechen oder Hören des Wortes erleben.
| | |
| | | / | | | Die Quelle
des Fehlers scheint die Idee vom Gedanken zu sein der
den Satz begleitet. Oder der seinem
symbolischen Ausdruck vorangeht. Dem
Wortausdruck kann natürlich ein andrer Ausdruck
vorangehen aber für uns kommt der Artunterschied
Unterschied |
dieser beiden Ausdrücke – oder
Gedanken – nicht in Betracht. Und es kann der Gedanke
unmittelbar in seiner Wortform
.
| | |
| | | / | | |
„Er hat diese Worte gesagt, sich
aber dabei gar nichts gedacht.”
„Doch, ich habe mir etwas dabei
gedacht.” – „Und zwar was
denn?” – „Nun, das was ich gesagt
habe”.
| | |
| | | / | | |
Man muß sich aber hüten die
Vorstellungen die ein Wort begleiten nebensächliche
Begleiterscheinungen – sozusagen Abfallsprodukte – zu
nennen. Sie können sehr wesentlich & wichtig
sein aber für uns sind sie nur von Interesse insofern
sie wieder Glieder eines Kalküls also Symbole sind.
Und als solche sind sie den Worten
beigeordnet
gleichberechtigt |
sind
aber nicht „die Bedeutungen” der Worte.
| | |
| | | | | | „Dieses Wort hat doch eine
ganz bestimme Bedeutung”. Wie ist sie denn
ˇganz bestimmt?
| | |
| | | | | | Man kann keinen
Es
läßt sich kein |
Grund
angeben, weswegen man denken soll.
Es sei
denn ein Grund von der Art dessen weswegen man essen soll.
| | |
| | | / | | | Man kann
einen Gedanken aus anderen begründen aber nicht das
Denken. Das, glaube ich, ist es, was unsere
Untersuchung rein beschreibend macht.
| | |
| | | / | | |
30.
Ich glaube, wenn einer sagt „ich weiß doch, was das
Wort ‚Gelb’ bedeutet”, so ruft er
sich eine Vorstellung auf, oder er meint gar nichts.
Oder aber er meint es ganz so, wie man sagt: „ich
kann Schach spielen, aber nicht Dame”.
| | |
| | | / | | | Wie, wenn man
fragte: Wann kannst Du Schach spielen?
Immer? oder während Du es sagst? aber
während des ganzen Satzes? – Und wie seltsam,
daß Schachspielen-Können so kurze Zeit
& eine Schachpartie soviel
länger!!
| | |
| | | ∫ | | |
Beschreibst Du damit eine
Disposition?
| | |
| | | / | | |
Wenn nun „das Wort
‚gelb’ verstehen” heißt, es anwenden
können, so die
gleiche Frage: Wann kannst Du es
anwenden. Redest Du von einer Disposition?
Ist es eine Vermutung?
| | |
| | | ∫ | | |
„Ich kann Schach spielen. – Aber in dem Moment habe ich ganz vergessen wie, –
aber ich habe es unzählige Male gespielt.”
| | |
| | | | | | Kannst Du das Alphabet?
Bist Du sicher? – Ja! – Ist
das damit vereinbar, daß Du versuchen wirst es herzusagen &
stecken bleiben wirst? – Ja!
Das ist doch der g[e|l]eiche Fall
wie: „Kannst Du Deinen Arm
heben?” In welchem Falle würde ich dies
verneinen müssen, oder bezweifeln? Solche
Fälle sind leicht zu denken.
| | |
| | | ∫ | | | Als Die
Bestätigung dessen, daß wir den Arm heben können sehen
wir, ˇetwa, ein in einem Zucken mit den Muskeln an oder
eine kleine einer kleinen Bewegung des Arms. Oder die
geforderte in der geforderten Bewegung selbst, jetzt ausgeführt, als
Criterium dafür, daß ich sie gleich
darauf ausfuhren kann.
| | |
| | | ∫ | | | Daß ich
etwas tun kann, ist entweder eine Hypothese die die
Bestatigung durch die Tat erwartet, oder es
wird dadurch verifiziert daß ich etwas dieser Tat
verwandtes , & sagt daher eben nur dies.
| | |
| | | / | | | Das
Können, & Verstehen wird scheinbar als
Zustand beschrieben wie der Zahnschmerz, & das ist die falsche
Analogie unter der ich laboriere.
| | |
| | | ⁎ / | | | Der Gebrauch des
Wortes „Tatsache” &
„Tat”. – „Das war eine edle
Tat”. – „Aber das ist ja nie
geschehen”. – Es liegt nahe das Wort Tat so
gebrauchen zu wollen daß es nur dem wahren Satz
entspricht. Man redet dann also nicht von einer Tat die
getan wurde. Aber der Satz
„das war eine edle Tat” muß doch einen Sinn behalten auch wenn
ich mich darin irre daß geschehen ist was ich die Tat
nenne. Und darin liegt bereits alles Wichtige & ich
kann nur die Bestimmung treffen daß ich die Wörter Tat,
Tatsache (etwa auch Ereignis) nur in einem
S Ko Satz verwenden
◇◇◇ werde der, complett, das Bestehen
dieser Tatsache behauptet.
| | |
| | | | | |
(p ∙ q) ⌵
(p·~q) ⌵ (~p ∙ q)
⌵
(~p ∙ ~q): das wird
meine Tautologie, & ich würde dann nur sagen, daß sich
der Logik” nach bestimmten Regeln auf diese Form bringen
läßt. Das heißt aber dasselbe : sich von ih[m|r] ableiten läßt;
& hier wären wir bei der
Russellschen
der Demonstration
angelangt & alles, was wir dazusetzen ist nur,
daß diese Form diese Ausgangsform selber
kein Satz selbständiger Satz ist &
ˇdaß dieses & alle anderen
„[Sät|Geset]ze
der Logik” die Eigenschaft haben
p ∙ Log = p,
p ⌵ Log = Log.
| | |
| | | ∫ | | | Eine Absicht
haben, etwas tun können, sich etwas wünschen (eine
Absicht, eine Fähigkeit, einen Wunsch haben) wird als
Tonus behandelt wie sich freu sich
freuen, freudig sein oder traurig. Nur soweit es
sich da um eine Disposition also um eine Eigenschaft ˇetwa des
Körpers handelt ist von einem (dauernden) Zustand die
Rede.
| | |
| | | / | | |
Absurde Fragen, wie „wie lange braucht man dazu Schach
spielen zu können” sind
einerseits absurd sind es einerseits weil es
Unsinn wäre zu fragen „wie lange braucht man dazu
Zahnschmerzen zu haben”, anderseits hat sie ihre scheinbare Rechtfertigung darin daß
weil
bringen sie rechtfertigen sie sich scheinbar weil |
sie die
Dauer aus der Frage „wie lange dauert eine
Schachpartie” in die Frage nach überträgt.
| | |
| | | ⁎ / | | | Zu
„Tat” & „Tatsache”:
Es wäre besser die Einschränkung in dem Gebrauch
dieser Wörter fallen zu lassen da sie nur irreführend wirkt
& ruhig zu sagen: „diese Tat ist nicht begangen
worden”, „diese Tatsache besteht nicht”,
„dieses Ereignis ist nicht
”.
| | |
| | | | | | Die der Verification
eines Satzes ist ein Beitrag zu seiner Grammatik.
| | |
| | | | | | Wir haben es also ˇin der
Logik mit dem Verstehen des Satzes nicht zu tun; denn wir
ˇselbst müssen ihn verstehen, daß er für
uns ein Satz ist.
| | |
| | | | | | Es
wäre ja auch seltsam, daß die Wissenschaft & die
Mathematik die Sätze gebraucht aber von ihrem Verstehen
nicht spricht.
| | |
| | | ∫ | | | (Das Talent ist ein Quell woraus immer
wieder neues Wasser fließt. Aber diese Quelle wird
wertlos, wenn sie nicht in rechter Weise wird, nämlich xxx xxxx
xxxxxx.)
| | |
| | | / | | |
Man sieht in dem Verstehen das
Eigentliche, im Zeichen das Nebensächliche. –
Übrigens, wozu dann das Zeichen überhaupt? –
N[ü|u]r um sich Andern verständlich zu
machen? Aber wie ist das überhaupt
möglich. – Hier wird das Zeichen als eine Art
Medizin daß im andern
die gleichen Magenschmerzen hervorrufen soll, wie ich sie
habe.
| | |
| | | ∫ | | |
In der Philosophie werden wir durch einen Schein
getäuscht. Aber Schein ist
auch etwas, & ich muß ihn einmal ganz klar mir vor Augen
stellen, ehe ich sagen kann, daß es nur ein Schein ist.
| | |
| | | | | | In
wiefern ist eine
rote Tafel18 ein besseres Zeichen für
rot19 als das Wort ‚rot’?
| | |
| | | | | | (Versuch', das einmal ohne das Wort
‚rot’, in den Plätzen 1 & 2, zu
sagen!)
| | |
| | | | | |
Oder: heißt es etwas, zu sagen, daß das Wort
‚rot’, um ein brauchbares Zeichen zu sein, ein
Suplement – etwa im Gedächtnis –
braucht?
D.h.
in wiefern ist es allein nicht Zeichen,
& besteht nicht ein Irrtum, wenn wir glauben, daß noch
etwas zur Erzeugung Zeichens
nötig ist?
| | |
| | | / | | |
(Das Wort ‚rot’ ist
ein Stein in einem Kalkül, & das rote
Täfelchen ist auch einer.)
| | |
| | | / | | | Ich möchte sagen, der
Schritt den wir bei der Erfüllung des Zeichens machen, kann
auch nur beschrieben, nicht bezeichnet werden.
| | |
| | | | | | Oder will ich sagen: die
Identifizierung ist nur durch eine Beschreibung möglich?
| | |
| | | / | | | Das Wahre am
Idealismus ist eigentlich, daß der Sinn des Satzes aus seiner
Verification ganz hervorgeht.
| | |
| | | ∫ | | |
Heiß. Die Luft (istc)
von ekelhaften Tieren bevölkert.
| | |
| | | / | | | Wenn der Idealismus sagt,
der Baum sei nur meine Vorstellung so ist ihm vorzuhalten daß der
Ausdruck „dieser Baum” nicht die
selbe Bedeutung hat wie „meine Vorstellung
von diesem Baum”. Sagt der Idealismus, meine
Vorstellung allein existiert ˇ(hat Realität), nicht
der Baum so mißbraucht er das Wort „existieren”
oder „Real⌊i⌋tät haben”.
1.) Du scheinst ja hier zu sagen daß etwas
von der die Vorstellung gilt was nicht vom Baum eine
Eigenschaft hat die der Baum nicht hat. Aber wie weißt Du das?
Hast Du alle Vorstellungen & Bäume daraufhin
untersucht? Oder ist das ein Satz a priori,
dann soll er in eine grammatische Regel gefaßt werden die sagt,
daß man von der Vorstellung etwas Bestimmtes mit Sinn
aussagen darf, was nicht aber vom Baum.
2.) Was soll es aber heißen von einer
Vorstellung Realität auszusagen? Dem
entsprechend
, daß diese
Vorstellung vorhanden ist. In anderm Sinne –
freilich – sagen wir aber auch von einem Baum aus, er existiere
(habe Realität) im Gegensatz zu dem Fall etwa daß er
bereits umgehauen ist. Und es bleibt nur
übrig, daß das Wort „Baum” in der Bedeutung
in der man sagen kann „der Baum wird umgehauen
& verbrannt” einer anderen grammatischen
Kathegorie angehört als
d[as|er] Wort Ausdruck
„ Vorstellung
” etwa im
Satz: „meine Vorstellung vom Baum wird immer
undeutlicher”. Sagt aber der Realismus die
Vorstellungen seien doch „nur die
subjectiven der Dinge” so ist zu sagen daß dem
ein falscher
Vergleich
eine falsche Analogie |
zwischen der Vorstellung von einem Ding
& dem Bild des Dinges zu Grunde
liegt. Und zwar einfach weil es wohl möglich ist ein
Ding zu sehen & sein Bild (etwa nebeneinander)
aber nicht ein Ding & die Vorstellung davon.
Es handelt sich um die Grammatik des Wortes
‚Vorstellung’ im Gegensatz zur Grammatik der
‚Dinge’.
| | |
| | | ∫ | | |
„Wie ist weiß?” –
„Ein Schwan ist weiß”.
| | |
| | | / | | | Ja, was einen Satz
erfüllt, kann in der Sprache nur durch einen Satz
niedergelegt werden. Und wenn durch ein gemaltes oder
Bild, so ist dieses Bild ein
Satz.
| | |
| | | / ∫ | | |
(Ich will sagen, ich kann mich
auch nicht darüber beschweren, daß dieses Zeichen nicht die
nötige Multiplizität hat, außer in einer
Sprache die sie hat.)
| | |
| | | ∫ | | |
Wenn ich die Bedeutung (eines
Zeichens) festlegen will, so muß ich sie allgemein, d.i. durch eine Beschreibung, festlegen
& nicht gleichsam
für den besonderen Fall.
| | |
| | | ∫ | | |
Der besondere Fall läßt sich
als solcher in gewissem Sinne als solcher nicht
beschreiben.
(Das ist natürlich alles
ganz unkorrekt ausgedrückt, aber der richtige Ausdruck
dafür ist, was ich suche)
| | |
| | | | | | Wenn ich eine Erfahrung mit den Worten
beschreibe „vor mir steht ein blauer Kessel”, ist
die Rechtfertigung dieser Worte, außer der Erfahrung die in den
Worten beschrieben wird, noch eine andere, etwa die Erinnerung, daß
ich das Wort ‚blau’ immer für diese Farbe
verwendet habe, etc?
| | |
| | | | | | Oder umgekehrt: Was, außer
dem Befehl rechtfertigt die Handlung die ihm folgt?
| | |
| | | ø \ | | |
Es ist
y beschämend sich als leerer
Schlauch zeigen zu müssen, der nur vom Geist
aufgeblasen wird.
| | |
| | | ? / | | |
Wenn ich jemanden sage:
„Wenn ich läute, komm zu mir”, so wird er
zuerst, wenn er läuten hört, sich diesen Befehl ˇ(das
Läuten) in Worten übersetzen & erst
den übersetzten befolgen. Nach einiger Zeit aber
wird er das Läuten ohne Intervention anderer Zeichen in die
Handlung übersetzen.
Und so, wenn
ich sage „zeige auf einen roten Fleck”, befolgt er
diesen Befehl, ohne daß ihm dabei zuerst das Phantasiebild eines
roten Flecks als Zeichen für ‚rot’
erscheint.
| | |
| | | ∫ | | |
Die Multiplicität
hängt davon ab, zwischen welchen Möglichkeiten
eine Wahl ist.
| | |
| | | / | | |
Wenn er läutet, so komme ich zu ihm,
ohne mir erst ein Bild meiner Bewegungen vorzustellen,
wonach ich ˇdann handle.
| | |
| | | ø \ | | |
(Ich sollte mein Buch vielleicht mit der Analyse eines
[A|a]lltäglichen Satzes, etwa „auf meinem
Tisch steht eine Lampe”, anfangen. Von da aus müßte
man überall hin gelangen können.
Das entspricht auch dem Gefühl, was ich schon vor
längerer Zeit hatte, daß ich nämlich mein Buch mit einer
Naturbeschreibung d.h. überhaupt mit
der Beschreibung einer Situation beginnen sollte. Um
ihr das Material für alles weitere zu
erhalten.)
| | |
| | | ? / | | |
1.7. Wenn er nun
heute läutet, so kann (nicht muß) ich mich doch dran
erinnern, daß er das auch gestern getan hat & ich auch
gestern zu ihm gegangen bin. (Wie ich mich auch erinnern
könnte, gestern auf das Läuten hin etwas anderes getan
zu haben). Und dann wäre diese Erinnerung auch ein
Zeichen dem ich folgen kann. – Der Befehl könnte
auch lauten: tu heute, was Du gestern auf das Läuten
(hin) getan hast. Und nun
kann ich mich nach dem Erinnerungsbild richten; aber jetzt hat
es keinen Sinn, eine weitere Anweisung dafür zu verlangen, wie ich mich nach
diesem Bild richten soll. Und darin besteht eigentlich, was
ich sagen will.
| | |
| | | ? / | | |
Wenn ich sage, jedes Bild braucht
noch eine Interpretation, so heißt
‚Interpretation’ die Übersetzung in ein
weiteres Bild oder in die Tat.
| | |
| | | / | | |
Aber wie stimmt das mit der Behauptung
überein, daß der Befehl seine Befolgung bestimmt – wird
dem nicht dadurch widersprochen, daß man sagt, der
Befehl müsse interpretiert werden (auch wenn er in Form eines
Model⌊l⌋s der Tat gegeben wäre)? Nein;
bestimmt wird die Tat durch den Befehl nur insofern, als sie aus
ihm ableitbar ist wie
5² aus
x²,
x = 5
| | |
| | | / | | |
D[ie|u] beziehst von dem
Befehl die Kenntnis dessen, was Du zu tun hast.
Und doch gibt Dir der Befehl nur sich selbst, & seine
Wirkung ist gleichgültig.
| | |
| | | / | | | Der Befehl sagt mir, was
ich zu tun habe; er kann es mir nur in sich selbst mitteilen.20
| | |
| | | / | | |
D.h. er muß alles, was wir mit dieser
Mitteilung meinen in sich haben.21
| | |
| | | / | | |
Ich
weiß was ich zu tun habe, heißt eben nicht, daß es
geschieht.
| | |
| | | / | | |
Das wird erst dann seltsam, wenn der
Befehl etwa ein Glockenzeichen ist. – Denn in welchem
Sinne mir dieses Zeichen mitteilt was ich zu tun habe, außer daß
ich es tue und das Zeichen
da war
– –. Denn es ist auch nicht das, daß ich es
erfahrungsgemäß immer tue, wenn das Zeichen gegeben
wird.
| | |
| | | / | | |
Darum hat es ja auch ohne weiteres keinen Sinn zu
sagen: „Ich muß gehen, weil die Glocke
geläutet hat”. Sondern dazu muß noch etwas
anderes gegeben sein.
| | |
| | | | | |
∣ ||Normal – abnormal: Wir setzen
die Norm fest & betrachten sie dann als etwas a priori
gegebenes. ist eine gegebene Form der Darstellung. ∣
| | |
| | | / | | | Dieses
andere ist, oder hängt damit zusammen, daß ich es mir
– z.B. – vorgenommen habe, auf
das Glockensignal so zu handeln. Aber in dem
geschah es ja auch nicht,
daß ich so handelte & wenn ich auch eine Handlung
der selben Art ausführte so
ˇführte ich doch nicht die, die meinen Vorsatz
nicht aus und meine Handlung war ein weiteres Symbol.
Ich meine: Ich rede hier immer von
„dieser Handlung” (oder sage, ich habe mir
vorgenommen „so” zu handeln) aber damit
kann ich doch ein Bild von ihr
geben,.
| | |
| | | / | | |
(Aber auch das ist irreführend
ausgedrückt. „Nur ein Bild von
ihr”? Nur ein Bild wessen? – Hier sehen wir die Sache wieder so als
wäre etwas die Tatsache ein Ding– , etwa ein Mensch– ,
der sich hier befinden kann, was dem entspricht daß die Tatsache
besteht
wirklich eingetreten ist |
oder abwesend existent ist, & das entspräche nun dem Fall, daß diese
Tatsache nicht besteht
soll nun dem entsprechen daß diese Tatsache
nicht besteht |
. Denn wenn ich
sage, ⌊:⌋ ich habe auch hier
nur ein Bild von ihr, nicht sie selbst so setzt das
ˇnatürlich voraus daß ich sie selbst es
Sinn hat zu sagen ich sie selbst vor
mir im Gegensatz zu bloßen
Bild. Aber das könnte doch nur heißen daß sie
jetzt vor mir stattfindet was ich ja ausgeschlossen
habe
& daß das nicht der
Fall ist ist ja zugegeben |
. Der falsche Vergleich läßt es
erscheinen daß ich die Tatsache
könnte auch wenn sie (noch) nicht
eingetreten ist wie ich einen Menschen
wahrneh sehen kann auch wenn er nicht bei mir
im Zimmer ist. Und daß die Tatsache in irgend
ein welchem Sinn besteht (intakt ist) auch
wenn sie nicht eingetreten ist wie ein Mensch auch in sich
existiert auch wenn er nicht hier ist.)
| | |
| | | ? / | | |
D.h. [D|d]as Vornehmen der Vorsatz könnte entweder in Worten, oder
Phantasiebildern bestehen oder auch darin daß ich eine Handlung
wie die vorgenommene selbst ausführte.
| | |
| | | ? / | | |
∣ Wie unterscheidet sich denn das Vornehmen dieser
Handlung vom Vornehmen einer anderen? ∣
| | |
| | | | | | Wenn ich nun bei einem
[W|w]eiteren Glockenschlag wieder so handle, so ist diese
Wi⌊e⌋derholung keine hypothetische, sondern ich wiederhole die
Handlung bewußt. D.h.
richte mich nach meiner Erinnerung.
| | |
| | | ø \ | | |
Niemand will den Andern gerne verletzt haben; darum tut es jedem so gut,
wenn der andere sich nicht verletzt zeigt. Niemand will
gerne eine beleidigte Leberwurst vor sich haben. Das
merke Dir. Es ist viel leichter dem Beleidiger
geduldig – & duldend – aus dem
Weg ge[s|h]en, l als ihm
freundlich entgegengehn. Dazu gehört auch
Mut.
| | |
| | | ? ∫ | | |
Wenn immer ich über die
Erfüllung eines Satzes rede, rede ich über sie im
Allgemeinen. Ich beschreibe sie in irgendeiner
Form. Ja es liegt diese Allgemeinheit schon darin,
daß ich die Beschreibung zum Voraus geben kann &
jedenfalls unabhängig von dem Eintreten der
Tatsache.
| | |
| | | / | | |
(Das sind schwere grammatische
Erkrankungen die diese Sätze .)
| | |
| | | ? / | | |
Wenn ich sage „ich rede
über die Erfüllung des Satzes im
allgemeinen, so meine ich, ich rede mit Worten die nicht für
diese
Gelegenheit
sind.
| | |
| | | ? / | | |
Alles ist natürlich schon in
den Worten „ich beschreibe die Tatsache”
.
& Und (alles) was ich
machen kann ist nur falsche Deutungen von diesem Ausdruck
von diesem
Satz |
fern zu
halten. Falsche Vergleiche die sich
zudrängen auszuschließen.
| | |
| | | | | | Die oberen Sätze z.B.
sind nur gut sie die
Krankheiten der Auffassungen zeigen & soweit sie sie
klar zur Anschauung
zum Ausdruck |
bringen. Die Heilung aber ist das Aufzeigen des
irrefuhrenden Bildes das zu diesen
Sätzen führt.
| | |
| | | / | | |
Wenn man sagt wir sagen,
daß wir die Tatsachen die Tatsache auf „allgemeine
Art” beschreiben beschrieben wird, so setzen wir diese Art
einer im Geiste einer
anderen
entgegen. (Diese Entgegenstellung nehmen wir aber
natürlich von wo anders her.)
Wir denken uns daß bei der Erfüllung etwas Neues entsteht
& nun da ist was früher nicht da war. Das
heißt wir denken an einen Gegenstand oder Komplex auf den wir nun
zeigen können, beziehungsweise, der sich nun selbst
repräsentieren kann, während die Beschreibung nur sein
Bild war. Wie wenn ich den Apfel der auf diesem Zweig
wachsen wird zum Voraus gemalt hätte, nun aber er
selber kommt. Man könnte dann sagen die Beschreibung
des Apfels war allgemein d.h. mit Wörtern,
Farben etc. bewerkstelligt die schon vor dem Apfel
& nicht speziell für ihn da waren. Gleichsam
altes Gerümpel im Vergleich mit dem wirklichen Apfel.
die alle
abdanken müssen wenn der Erwartete ˇselber
kommt.
| | |
| | | / | | |
Aber der Erwartete ist nicht die
Erfüllung sondern: da[s|ß] er gekommen
ist.
| | |
| | | / | | |
Dieser Fehler ist tief in unserer Sprache verankert:
Wir sagen „ich erwarte ihn” &
„ich erwarte sein Kommen” & „ich
erwarte daß er kommt”
| | |
| | | / | | | Die Tatsache wird
allgemein beschrieben heißt, sie wird aus alten
Bestand-teilen zusammengesetzt.
Sie wird beschrieben, das ist so, als wäre sie uns
außer durch die Beschreibung noch anders gegeben.
| | |
| | | / | | | Hier wird
die Tatsache mit einem Haus oder einem Complex
gleichgestellt.
| | |
| | | | | |
Noch einmal der Vergleich: die Tatsache tritt ein
der Mensch tritt ein – die Tatsache das
Ereignis tritt ein: [a|A]ls wäre die
Tatsache das Ereignis schon vorgebildet vor der Tür der
Wirklichkeit & würde nun in diese eintreten wenn
sie es eintritt.
| | |
| | | / | | |
Complex ≠ Tatsache. Denn von
einem Complex sage ich
ˇz.B. er bewege sich von einem Ort zum
andern aber nicht von einer Tatsache.
Daß
aber dieser Complex sich jetzt dort befindet ist
eine Tatsache.
| | |
| | | / | | |
Man kann im Deutschen auch sagen
„in diesem Zimmer bilden die drei Vasen ein
Ornament” oder (wenn auch geschraubt) „in
diesem Zimmer besteht die Tatsache daß …”,
& das ist gleichbedeutend mit: in diesem Zimmer befindet
sich das Ornament (der Complex) der drei
Vasen.
| | |
| | | / | | |
„Wenn ein
Complex von Kugeln in diesem Raum liegt”
= „wenn Kugeln in diesem Raum in einer beliebigen
irgend einer |
Anordnung
stehen”
| | |
| | | | | |
„Dieser Gebäudekomplex wird eingerissen”
=
„die Gebäude die so beisammen stehen werden
eingerissen”.
| | |
| | | / | | | Die
Blume, das Haus, das Sternbild nenne ich
Complexe, und zwar von Ziegeln, von
Blättern, von Sternen etc.
Daß dieses Sternbild hier steht, kann allerdings durch einen
Satz beschrieben werden, worin nur von seinen Sternen die Rede ist
& das Wort Sternbild oder sein Name nicht vorkommen.
| | |
| | | / | | | Aber das
ist auch alles, was man von der Beziehung zwischen
Complex & Tatsache sagen
kann⌊.⌋,
[&|Und] Complex ist ein
räumlicher Gegenstand bestehend aus räumlichen
Gegenständen. (Wobei ◇◇◇ der Begriff
‚räumlich’ einiger Ausdehnung fähig
ist.)
| | |
| | | / | | |
Ein Complex besteht
aus seinen Teilen, den gleichartigen Dingen die ihn
bilden (Dies ist natürlich ein Satz der
Grammatik über die Wörter
‚Complex’,
& ‚Teil’ &
‚bestehen’.)
| | |
| | | / | | | Zu sagen ein roter Kreis
bestehe aus Röte & Kreisförmigkeit oder
sei ein Complex aus diesen Bestandteilen ist ein
Mißbrauch dieser Wörter & irreführend
(Frege wußte
dies).
Ebenso irreführend zu sagen,
die Tatsache daß dieser Kreis rot ist oder
(ˇdaß ich müde bin⌊)⌋, sei ein
Complex aus ˇden Bestandteilen Kreis
& Röte; bezw.
⌊(⌋ ⌊(⌋mir Ich & der
Müdigkeit).
| | |
| | | / | | |
Auch ist das Haus nicht ein
Complex aus den Ziegeln & ihren
räumlichen Beziehungen. D.h.
auch das ist gegen den richtigen Gebrauch der
W[ö|o]ter des Wortes.
| | |
| | | / | | | Man
kann nun zwar auf eine Constellation zeigen
und sagen: diese Constellation besteht ganz
aus Bestandteilen Gegenständen Dingen die ich schon kenne; aber man kann nicht
‚auf eine Tatsache zeigen’ & dies
sagen.
| | |
| | | / | | |
Ich kann nicht ˇmit dem Finger auf
etwas zeigend sagen: „schau Dir diese Tatsache
an”. & Denn dann würde
der Andere mit Recht fragen „welche Tatsache”
& als Antwort müßte ein Satz kommen der
das die Tatsache aussagt & nicht etwa
die Bemerkung „nun diese hier”, wie
man antworten könnte wenn auf die Frage
gewesen „welche welches
meinst
Du?”.
| | |
| | | / | | |
Der Ausdruck „eine Tatsache
beschreiben” oder „die Beschreibung einer
Tatsache” für die Aussage die ihr das
Bestehen der Tatsache behauptet ist auch irreführend,
weil so klingt wie
„das Tier beschreiben, das ich gesehen
habe”.
| | |
| | | / | | |
Man sagt freilich auch „auf eine
Tatsache hinweisen” aber das heißt immer „auf die
Tatsache hinweisen daß …”. Dagegen
heißt „auf eine Blume zeigen (oder
hinweisen) nicht, darauf hinweisen daß diese
Blüte auf diesem Stengel sitzt; denn von dieser Blüte
& diesem Stengel braucht da gar nicht die Rede zu
sein.
| | |
| | | / | | |
Ebensowenig kann es heißen auf die Tatsache hinweisen, daß
dort diese Blume steht.
| | |
| | | / | | |
Auf eine Tatsache hinweisen, heißt
etwas behaupten, aussagen. ‚Auf eine Blume
hinweisen’ heißt das nicht.
| | |
| | | / | | | Auch die Kette besteht
ˇnur aus ihren Gliedern, nicht aus ihnen und räumlichen Beziehungen.
| | |
| | | / | | | Die Tatsache, daß diese
Glieder so zusammenhängen besteht aus gar
nichts.
| | |
| | | / | | |
Die Wurzel dieser Verwechslung ist der
verwirrende Gebrauch des Wortes
„Gegenstand”.
| | |
| | | / | | | Der Teil kleiner als das
Ganze. Das gäbe auf Tatsache &
Constituent angewandt eine
Absurdität.
| | |
| | | / | | |
Man kann in der Logik die
Allgemeinheit nicht weiter ausdehnen als unsere logische
Voraussicht reicht. Oder richtiger: als unser
logischer Blick reicht.
| | |
| | | ø \ | | |
In meiner Autobiographie müßte ich trachten mein Leben ganz
wahrheitsgetre[ü|u] darzustellen &
zu verstehen. So darf meine
unseldensafte
Natur nicht als ein bedauerliches
accidens erscheinen, sondern
vben als eine wesentliche Eigenschaft (nicht
eine Tugend). Wenn ich es durch einen Vergleich klar
machen darf: Wenn ein
„Straßenköter” sein seine Biographie schriebe, so
bestunde drv Gefahr
A) daß er entweder seine Natur verleugnen, oder
B) einen Grund ausfindig machen würde auf sie
stolz zu sein, oder C) die Sache so darstellte
als sei diese seine Natur eine
nebensachliche Angelegenheit.
Im ersten Falle lügt er, im zweiten ahmt er eine nur dem Naturadel natürliche
Eigenschaft, den Stol[a|z] nach der ein vitium
splendidum ist das er ebensowenig b
wirklich besitzen kann, wie ein krüppelhafter
Körper natürliche Gracie. Im
dritten Fall macht er gleichsam die
sozialdemokratische Geste, die die Y Bildung
über die rohen Eigenschaften des
Korpers stellt, aber auch das ist ein
Betrug. Er ist was er ist & das ist zugleich
wichtig & bedeutsam aber kein Grund zum Stolz anderseits immer
Gegenstand der Selbstachtung. Ja ich
kann den Adelsstolz des Andern & seine Verachtung
meiner Natur anerkennen, denn ich erkenne ja dadurch nur meine Natur
an & den andern der zur Umgebung meiner Natur, die Welt, deren
Mittelpunkt dieser vielleicht häßliche Gegenstand, meine
Person, ist.
| | |
| | | ø \ | | | Ich könnte
mir denken, daß ich die Wahl gehabt hätte, ein Wesen der Erde
als die Wohnung für meine Seele zu wählen & daß
mein Geist dieses unansehnliche
(nicht-anziehende)
Geschöpf als seinen Sitz & Aussichtspunkt
gewählt hätte. Etwa, weil ihm die Ausnahme eines schönen
Sitzes zuwider wäre. Dazu
müsste freilich der Geist seiner selbst
sehr sicher sein.
| | |
| | | ø \ | | | Man könnte
sagen „jeder Aussicht ist ein Reiz abzugewinnen”,
aber das wäre falsch. Richtig ist es, zu sagen, jede
Aussicht ist bedeutsam für den der sie bedeutsam sieht (das
heißt aber nicht, sie anders sieht als sie ist). Ja,
in diesem Sinne, ist jede Aussicht gleich bedeutsam.
| | |
| | | ø \ | | | Ja, es ist
wichtig, daß ich mir die Verachtung des Andern für mich
ˇmir zu eigen machen muß, als einen wesentlichen &
bedeutsamen Teil der Welt von meinem Ort gesehen.
| | |
| | | ∫ | | | (Mein Buch
könnte auch heißen: Philosophische
Grammatik. Dieser Titel hätte zwar den Geruch eines
Lehrbuchtittels aber das macht ja nichts, da das
Buch hinter ihm steht.)
| | |
| | | ∫ | | |
Nicht: jedes Bild braucht noch
eine Interpretation; sondern: jedes Bild ist noch einer
Interpretation fähig.
| | |
| | | ∫ | | | alle Erfindungen vernichten & zu dem
kommen, was schon immer da war & jeder kennt.
| | |
| | | ∫ | | | Die Irrfahrten tun
gut, wenn man zurückkehrt.
| | |
| | | ∫ | | | „Gesetz des
ausgeschlossenen Dritten” dieser Ausdruck ist zu vergleichen
dem Ausdruck „mit ohne”; wenn man ein Kind fragt „willst Du
lieber Kaffee Deine Semmel mit Schlagobers
Butter oder ohne” & es antwortet
„bitte mit ohne”. Als ob der Mangel an
Butter, der Butter so zugeordnet wäre, wie Schmalz der Butter, so
daß auch noch von einem Dritten die Rede sein könnte,
welches man
ausschließt
ausgeschlossen wird |
| | |
| | | / | | | Man kann nur scheinbar
„über jede mögliche Erfahrung
hinausgehen”; ja, dieses Wort hat auch
nur scheinbar Sinn, weil es nach Analogie sinnvoller
Ausdrücke gebildet ist.
| | |
| | | ∫ | | |
„Vielseitige Betrachtung der
”
| | |
| | | ø \ | | | Wenn es einem
Menschen freigestellt wäre ˇsich in
eine[m|n] Baum eines Waldes geboren zu werden
gebären zu lassen: so gäbe es [s|S]olche, die
sich den schönsten oder höchsten Baum aussuchen würden,
solche die sich den kleinsten wählten & solche die sich
einen Durchschnitts- oder minderen
Durchschnittsbaum wählen würdenc,
& zwar meine ich nicht aus
Phil[o|i]strosität, sondern aus
eben dem Grund, oder der Art von Grund, warum sich der Andre den
höchsten gewählt hat. Daß das Gefühl
welches wir für unser Leben haben mit dem eines solchen Wesens,
das sich seinen Standpunkt in der Welt wählen konnte,
vergleichbar ist, liegt, glaube ich, dem Mythus – oder dem
Glauben – zu Grunde, wir hätten uns
unsern Körper vor der Geburt gewählt.
| | |
| | | / | | |
Die
„Philosophie des Als Ob” beruht
auf dieser Verwechslung Gleichnis & Wirklichkeit.
| | |
| | | ? / | | | Die
Erfüllung des Satzes ‚p ist der Fall’
ist: daß p der Fall ist. Und weiter
nichts.
| | |
| | | / | | |
2. In den alten Riten
haben wir den Gebrauch einer äußerst ausgebildeten
Gebärdensprachevor uns ⌊.⌋
Und wenn ich in Frazer lese so möchte ich auf Schritt & Tritt
sagen: Alle diese Prozesse & ˇdiese
Wandlungen ˇder Bedeutung haben wir noch in unserer Wortsprache
vor uns. Wenn d[as|[ie|as]]
ˇwas sich in der letzte⌊n⌋
Bundel Garbe
ˇverbirgt der Kornwolf genannt wird, aber auch
ˇdiese Garbe selbst, & auch der Mann der sie bindet,
& ˇaber auch der Kuchen den er ißt, so
erkennen wir hierin einen
uns wohlbekannten uns wohlbekannten
sprachlichen Vorgang.
| | |
| | | ø | | |
Unsere Sprache ist eine
Verkörperung alter Mythen. Und der Ritus der alten
Mythen war eine Sprache.
| | |
| | | ø | | |
„Das ist keine
Erfahrung, das ist eine Idee.”
(Schiller)
| | |
| | | ø | | |
„Und so deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz”
möchte man zu der Frazerschen Samm Tatsachensammlung
sagen. Dieses Gesetz, diese Idee, kann ich nun
durch eine [e|E]ntwicklungshypothese
oder
auch, analog dem Schema einer P⌊f⌋lanze durch das Schema
einer religiösen Zeremonie oder aber durch die Gruppierung des
Tatsachen-Materials allein, in einer
„übersichtlichen” Darstellung.
| | |
| | | / | | |
Der Begriff der
übersichtlichen Darstellung ist für uns von grundlegender
Bedeutung. Er bezeichnet unsere Darstellungsform, die
Art wie wir die Dinge sehen. (Eine Art der
‚Weltanschauung’ wie sie scheinbar für unsere
Zeit typisch ist.) Spengler)
| | |
| | | / | | |
Diese übersichtliche Darstellung
vermittelt das
welches eben darin besteht daß wir die „Zusammenhänge
sehen”. Daher die Wichtigkeit der
Zwischenglieder [ des Findens von
Zwischengliedern ]
| | |
| | | ø | | | Ein
Hypothetisches Zwischenglied aber soll in diesem
Falle nichts tun als die Aufmerksamkeit auf die
Ähnlichkeit, den Zusammenhang, der wirklichen
Tatsachen lenken. Wie wenn man eine interne
Beziehung der Kreisform zur Elipse dadurch
illustrierte
illustrieren wollte |
daß man
eine Elipse allmählich in einen Kreis
überführt; aber nicht um zu behaupten daß eine
gewisse Elipse tatsächlich, historisch, aus einem
Kreis entstanden wäre
(Entwicklungshypothese) sondern nur um
unserem Auge für einen formalen Zusammenhang
zu schärfen.
Aber auch die
Entwicklungshypothese kann ich als weiter nichts sehen als
Einkleidung eines formalen
Zusammenhangs.
| | |
| | | ø \ | | |
„Was der
Gescheite weiß, ist schwer zu wissen.” Hat die
Verachtung Goethes für das Experiment im Laboratorium und die Aufforderung in die freie
Natur zu gehen & dort zu lernen, hat dies mit dem Gedanken zu
tun daß die Hypothese (unrichtig aufgefaßt) schon
eine Fälschung der Wahrheit ist? Und mit dem
Anfang den ich mir jetzt für mein Buch denke der in einer
Naturbeschreibung bestehen könnte? [ Und
mit dem Anfang den ich mir jetzt für mein Buch denke, der
Naturbeschreibung es anfangen soll? ]
| | |
| | | ø \ | | |
Denn mit den
„Hypothesen” sollte es anfangen, nicht mit den
„Sätzen”. Und richtiger wäre es
nun statt „Hypothese” „Satz”
zu sagen & statt des Wortes „Satz” wie ich
es jetzt gebraucht habe einen andern Ausdruck zu setzen.
| | |
| | | / | | | Die Hypothese
kann so aufgefaßt werden daß sie nicht über die
Erfahrung hinausgeht d.h. nicht der Ausdruck der
Erwartung künftiger Erfahrung ist. So kann der Satz
„es scheint vor mir auf dem Tisch eine Lampe zu
stehen” nichts weiter tun als meine Erfahrung
ˇ(oder, wie man sagt, unmittelbare Erfahrung) zu
beschreiben.
| | |
| | | / | | |
Wie verhält es sich mit der
Genauigkeit dieser Beschreibung. Ist es richtig zu
sagen: Mein Gesichtsbild ist so kompliziert, es ist
unmöglich es ˇganz zu beschreiben??
Dies ist eine sehr fundamentale Frage.
| | |
| | | / | | | Das scheint
nämlich zu sagen daß man von Etwas sagen könnte es
könne nicht beschrieben werden, oder nicht mit den ˇjetzt
vorhandenen Mitteln, oder (doch)
man wisse nicht, wie es
beschreiben. (Die Frage, das Problem, in der
Mathematik.)
Wie ist denn das Es gegeben, das
ich nicht zu beschreiben weiß? – Mein
Gesichtsbild ist ja kein gemaltes Bild oder d[ie|er]
Ausschnitt der Natur den ich sehe, so daß ich es
näher untersuchen könnte. – Ist dieses
Es schon artikuliert & die Schwierigkeit nur es in
Worten darzustellen, oder soll es noch auf seine Artikulation
warten?
| | |
| | | / | | |
„Die Blume war von einem
Rötlichgelb, welches ich aber nicht genauer (oder, nicht
genauer mit Worten) beschreiben kann.”
Was heißt das?
| | |
| | | / | | |
„Ich sehe es vor mir &
könnte es malen”
| | |
| | | / | | | Wenn man sagt, man
könnte diese Farbe nicht mit Worten genau beschreiben, so denkt
man (immer) an eine Möglichkeit
einer solchen Beschreibung (freilich, denn sonst hätte
„genaue
Beschreibung” keinen Sinn) und es
sch[ein|web]t
einem dabei der Fall einer Messung vor, die wegen
unzureichender Mittel nicht ausgeführt wurde.
⌊ Es ist mir nichts zur Hand was diese oder eine
ähnliche Farbe hätte. ⌋
| | |
| | | / | | | Die eigentlichen
Grundlagen seiner Forschung fallen dem Menschen gar nicht auf.
Es sei denn daß ihm dies einmal zum Bewußtsein gekommen
aufgefallen |
ist.
(Frazer etc
etc.)
| | |
| | | | | | Und das heißt, das Auffallendste
(Stärkste) fällt ihm nicht auf.
| | |
| | | / | | | Wollte man
Thesen in der Philosophie aufstellen, es könnte nie
über sie zur Diskussion kommen, weil [a|A]lle
mit ihnen einverstanden wären.
| | |
| | | ∫ ø | | |
Den Ausdruck
„der 3te Juni” empfinden wir nicht
als eine Abkürzung von „der 3te Tag des
Juni” sondern von „der 3te
Junitag”. Das Empfinden eines Ausdrucks als
Abkürzung (Veränderung) dieses, nicht jenes Ausdrucks,
ist ganz analog dem Sehen von  als eine Variante
von als eine Variante
von  , nicht von , nicht von
 . Der
Unterschied von eis und fin der
Musik ⌊.⌋ . Der
Unterschied von eis und fin der
Musik ⌊.⌋
| | |
| | | ∫ | | | „Die Spinne schwebt
in der Luft – nein, wenn man genauer zusieht, hängt sie an
einem „Faden”. Die visuelle Spinne
& die physikalische.
| | |
| | | ø \ | | | W
Wenn Menschen eine Blume oder ein Tier häßlich finden so
stehen sie immer unter dem Eindruck, es sei ein
Kunstprodukt. „Es schaut so aus wie
…”, heißt es dann. Das wirft ein Licht
auf die Bedeutun[t|g] der Worte
„häßlich” und
„schön”.
| | |
| | | / | | | Wenn man sagt, man
könne das Gesichtsbild nicht ganz beschreiben, so meint
man, man kann keine Beschreibung geben, nach der man sich dieses
Gesichtsbild genau reproducieren
könnte.
| | |
| | | / | | |
Aber was heißt hier „genaue
Reproduction”? Hier
liegt selbst wieder ein falsches Bild zugrunde.
| | |
| | | / | | | Was ist
das Criterium der genauen
Reproduction?
| | |
| | | ∫ | | | Wir können von dem
Gesichtsbild nicht weiter Rreden, als unsere Sprache
jetzt reicht. Und auch nicht meinen (denken) als unsere Sprache
.
(nicht mehr meinen als
wir sagen können)
| | |
| | | / | | | Einer der
gefährlichsten Vergleiche ist der des
Gesichtsfeldes
mit einer gemalten Fläche (oder, was auf dasselbe
hinauskommt, einem farbigen räumlichen Modell).
| | |
| | | / | | | Hiermit
hängt es zusammen: Könnte ich denn das
Gesichtsbild „mit allen Einzelheiten”
wiedererkennen? Oder vielmehr, hat diese Frage
überhaupt einen Sinn?
| | |
| | | / | | |
Denn als einwandfreiste Darstellung des
Gesichtsbildes erscheint uns immer noch ein gemaltes Bild oder
Modell. Aber, daß die Frage nach dem
„Wiedererkennen in allen Einzelheiten”
sinnlos ist, zeigt schon wie inadäquat Bild &
Modell sind.
| | |
| | | ∫ | | |
„Ich führe Dich einen Weg den
ich noch nie gegangen bin”. Problem des
Suchens.
| | |
| | | ø \ | | |
Wenn ein
Tier ursprünglich verehrt, [u|f]ür unrein geachtet wird, ist
das nicht der Vorgang, wenn wir eine Gewohnheit als Fehler ablegen
& dann ängstlich hassen?
| | |
| | | / | | | Man sagt „der
Mensch nährt mich”, der mir Nahrung gibt, aber
auch „die Nahrung nährt
mich”.
| | |
| | | ∫ | | |
„Ich habe ihm
p zu tun
befohlen” – „Nun
& was hat er getan?” –
„p” –
„Nun dann ist es ja in Ordnung”.
| | |
| | | ? / | | |
„Ich sagte, „geh
aus dem Zimmer” & er ging aus dem
Zimmer.” –
„Ich sagte,
„geh aus dem Zimmer” & er ging langsam aus
dem Zimmer”
„Ich sagte,
„geh aus dem Zimmer” & er sprang zum Fenster
hinaus”
Hier ist eine
Rechtfertigung möglich, auch wo die Beschreibung der Handlung
nicht die ist, die der Befehl gibt.
| | |
| | | / | | | Ich kann gewiß
sagen: „Tu jetzt, was Du ˇDeiner Erinnerung
nach gestern um diese Zeit getan hast”. Und
wenn er sich daran erinnert, kann er seiner Erinnerung folgen.
Erinnert er sich aber nicht, so hat der Befehl keinen Sinn für
ihn.
| | |
| | | / | | |
Wäre dieser Befehl also wie der: „Tu, was
auf dem Zettel in dieser Lade aufgeschrieben
steht”. Wenn in der Lade kein Zettel ist, so ist
das kein Befehl.
| | |
| | | ∫ | | |
„Sage, was Du mir gestern gesagt
hast”
| | |
| | | / | | |
Ist es nicht so: Wenn ich das
Signal für eine Tatigkeit setze, so
m[ü|u]ßte ich mir vornehmen können,
dieses Signal so zu gebrauchen. Aber damit
mußte ich es bereits mit einem andern Symbolismus
zusammenbringen.
| | |
| | | | | | Aber auch
wenn dieses Vornehmen so geschah, daß ich sagte, dieses Signal
das, &
führte dabei eine gewisse Tätigkeit aus, so muß die
Erinnerung an diese Tätigkeit später mit dem Zeichen
zusammenwirken
| | |
| | | ∫ | | |
Der Knopf im Taschentuch.
Bedeutet er: „Erinnere Dich an
etwas!”? Jedenfalls würden diese
Worte denselben Dienst leisten.
| | |
| | | / | | | Ich kann vergessen welche
Farbe ein Wort bezeichnet & auch, wie eine bestimmte Farbe
(etwa auf Englisch) heißt.
| | |
| | | ∫ | | | Ich werde aufgefordert mir
die Farbe Orange vorzustellen & habe vergessen was
‚orange’ .
Was geschieht hier? Und was geschieht, wenn ich
mich nun wieder daran erinnere? Die Frage ist
nämlich: wovon hängt es ab, ich der Aufforderung, mir die Farbe A vorzustellen,
folgen kann?
| | |
| | | / | | |
Noch eine Frage: Kann man von
verschiedenen Interpretationen des Gedächtnisbildes
sprechen? In welchem Sinne nicht?
| | |
| | | ∫ | | | (Wenn man
irgendwo von Vorurteilen gehemmt , dann in der Philosophie)
| | |
| | | ∫ | | |
„Male einen roten Streifen”. – „Ich habe vergessen, was ‚rot’
heißt, das Wort sagt mir nichts”.
| | |
| | | / | | | Wenn das Wort
‚rot’, um Bedeutung zu haben, eine Vorstellung
hervorrufen muß, die erst das eigentliche Bild ist, warum sollte es
da nicht genügen, wenn das Wort, mit einer wirklichen Farbe
confrontiert, ein bestimmtes Gefühl,
der etwa einer Befriedigung, auslöste?
| | |
| | | ∫ | | | Die
Rechtfertigung „Du hast mir gesagt ‚bring etwas
Rotes’, das heißt doch ‚rot’”
ist allgemein in dem früher gebrauchten
vorigenoben stehendem |
Sinn.
| | |
| | | ? / | | |
Sagte ich nicht, die Rechtfertigung müßte immer von der Art
sein:
schwarz … •; also: mach einen
S schwarzen Kreis …
•
| | |
| | | / | | |
Könnte denn die Rechtfertigung lauten: „Du hast
gesagt ‚bring etwas Rotes’ & dieses hier hat
mir daraufhin ein Gefühl der Befriedigung , darum habe ich es gebracht”?
| | |
| | | / | | |
Müßte man da nicht antworten: Ich habe Dir doch
nicht geschafft mir das zu bringen was Dir auf meine Worte hin ein
solches Gefühl geben wird!”
| | |
| | | / | | | Aber gälte
dieser Einwand nun auch, wenn ich geantwortet hätte:
„Du hast doch gesagt ich soll etwas Rotes bringen
& da habe ich mich erinnert, daß Du das
früher ‚rot’ genannt hast”.
Ich glaube, hier gälte der Einwand nicht.
| | |
| | | | | | Ich konnte mich auf jeden Fall zur
Rechtfertigung auf eine Tabelle der Farben Namen berufen.
| | |
| | | / | | | Es könnte aber auch
sein, daß ich mich so einer Tafel widersetze & mich auf
mein Gedächtnis (oder ist es etwas Andres?)
berufe.
| | |
| | | / | | |
Heißt das nun, daß ich in meinem
Gedächtnis gleichsam eine andere, anders lautende
Tafel habe?! Und was rechtfertigt die Wahl
zwischen diesen beiden?
| | |
| | | / | | |
Wenn ich jemandem sage „male das
Grün deiner Zimmertür nach dem Gedächtnis”,
so bestimmt das, was er
zu tun hat, nicht eindeutiger, als der Befehl „male das
Grün, was Du auf dieser Tafel siehst”.
| | |
| | | ∫ | | | („Der
Wind trägt meine Gedanken weg” –
„Gewicht einer
Energiemenge”)
| | |
| | | | | | Wenn es bei der Bedeutung des Wortes
„rot” auf das Bild ankommt, das mein Gedächtnis
beim Klang dieses Wortes automatisch reproduziert, so muß ich mich
auf diese Reproduktion gerade so verlassen, als wäre ich
determiniert, die Bedeutung durch nachschlagen in
einem Buche zu bestimmen, wobei ich mich diesem Buche quasi auf Gnade
& Ungnade ergeben würde.
| | |
| | | | | | Das würde aber heißen: Die
Bedeutung des Wortes ist, was mir in einer bestimmten Weise dabei
einfällt.
| | |
| | | | | | Ich bin dem
Gedächtnis ausgeliefert.
| | |
| | | ∫ | | | In irgendeinem Sinn
heißt es nichts „eine Farbe
wiedererkennen”.22
| | |
| | | | | |
Und doch kann ich sagen: „Wo
habe ich nur dieses Grün schon gesehen”, oder
„diese Farbenzusammenstellung”.
| | |
| | | | | | Ich möchte sagen:
Wiedererkennen läßt sich nur, was sich beschreiben
läßt.
| | |
| | | | | | Und nun
scheint „grün” die Beschreibung einer
Farbe zu sein!
| | |
| | | ∫ | | |
„Bring mir eine gelbe
Blume.” Wie rechtfertigst Du, was Du mir bringst?
| | |
| | | ∫ | | | Wenn Du
sagst „heißt denn diese Farbe nicht
‚gelb’?”, so bezieht sich Deine
Frage nur auf ein spezielles
Sprachübereinkommen[,| (]ist also
trivial[.|)]⌊.⌋
| | |
| | | ∫ | | | Wenn ich mit einem
gelben Täfelchen in der Hand nach einer gelben Blume suche, so
ist das analog dem Ausrechnen einer
Multiplication wie
165 × 280;
gehe ich aber mit dem Wort „gelb” suchen, so ist es
analog einem arithmetischen Satz
2 + 3 = 5,
wo nichts eine interne Relation zeigt.
| | |
| | | / | | | Es ist doch offenbar nicht
, daß
[e|E]iner die gelbe Blume so mit einem Phantasiebild
sucht, wie ein Anderer mit dem färbigen Täfelchen, oder ein
Dritter, in irgend einem Sinne, mit dem Bild einer Reaktion, die durch
das, was er sucht, hervorgerufen werden soll
(Klingel).
Womit immer aber er suchen
geht (mit welchem Paradigma immer), nichts zwingt ihn das als
das Gesuchte anzuerkennen, was er am Schluß wirklich
anerkennt, & die Rechtfertigung in Worten, oder andern
Zeichen, die er dann von dem gibt, rechtfertigt wieder nur im Bezug auf eine
andere Beschreibung in derselben Sprache.
| | |
| | | / | | | Die Schwierigkeit ist
aufzuhören, ‚warum’ zu fragen (ich meine,
sich dieser Frage zu enthalten).
| | |
| | | / | | |
Es ist offenbar ein Unterschied: ob
ich sage „dieser Streifen↑ ist weiß”, oder
„die Farbe dieses Streifens werde ich
‚A’ nennen”.
| | |
| | | / | | | Eine
‚Interpretation’ ist doch wohl etwas, was in Worten
gegeben wird! ist diese Interpretation im Gegensatz zu
einer anderen (die anders lautet). – Wenn man
also sagt „[J|j]eder Satz bedarf noch einer
Interpretation” so hieße das: kein Satz kann ohne
einen Zusatz verstanden werden, was Unsinn ist. – Sagt
man aber jeder Satz sei noch einer Interpretation fähig, so
heißt das, daß jedes Zeichen durch weitere Zusätze in
Systeme von noch größerer Multiplizität einzureihen
ist. Und dies wäre, wenn überhaupt etwas,
ein mathematischer Satz; [W|w]ie er aber da steht ist er,
glaube ich, vag & bedeutungslos.
| | |
| | | / | | | Wir können uns
denken, daß jemand die Bedeutungen der Farbnamen aus einer
Tabelle entnimmt, wo sie bei den entsprechenden Farben
stehen, bis er, wie man sagt, die Tabelle im Kopf
hat.23
| | |
| | | / | | |
Das heißt doch wohl, daß etwas
diese Tabelle ersetzt
hat.
| | |
| | | / | | |
Könnte nicht, was ich früher gegen den Gebrauch einer
ˇsolchen Tabelle eingewendet habe, gegen jede Rechnung
eingewendet werden?
| | |
| | | / | | |
Wie ist es mit den beiden
Sätzen: „dieses Blatt ist rot” &
„dieses Blatt hat die Farbe die auf Deutsch
‚rot’ heißt”? Sagen beide
dasselbe?
| | |
| | | / | | |
3.
Hängt das nicht davon ab, was das
Criterium dafür ist, daß eine Farbe auf
Deutsch ‚rot’ heißt?
| | |
| | | ? / | | | Kann man auch statt
„hol mir eine gelbe Blume” sagen:
„hol mir eine Blume, deren Farbe Du
[„|‚]gelb’
nennst”?
| | |
| | | / | | |
Wird der Ausdruck der Beschreibung nur von
dem Beschriebenen abgeleitet, oder aus diesem & einer Tabelle
oder etwas dem Analogen?
| | |
| | | ø \ | | |
Zu dem der
dich nicht mag, gut zu sein, erfordert nicht nur viel
Gutmütigkeit sondern auch viel
Takt.
| | |
| | | | | |
Du befiehlst mir „bringe mir eine gelbe
Blume”; ich bringe eine & Du fragst:
„warum hast Du mir so eine
gebracht?”. Dann hat diese Frage nur
ˇeinen Sinn, wenn sie zu ergänzen ist „und nicht
eine von dieser (andern) Art”.24
| | |
| | | / | | |
D.h. diese Frage gehört schon in
bezieht sich
schon auf |
ein System; und die Antwort
muß sich auf das gleiche System beziehen.
| | |
| | | / | | | Auf die Frage
„warum tust Du das auf meinen
Befehl?” Kann man fragen:
„Was?”
| | |
| | | / | | | Da wäre es nun absurd
zu fragen „warum bringst Du mir eine gelbe Blume, wenn
ich Dir befohlen habe, mir eine gelbe Blume zu
bringen”. Eher könnte man fragen
„warum bringst Du eine rote Blume, wenn ich sagte Du sollest
eine gelbe
bringen” oder „warum bringst Du eine dunkelgelbe auf
den Befehl ‚bring eine
gelbe’?”.
| | |
| | | / | | | Wie kann man die Handlung
von dem Befehl „hole eine gelbe Blume”
ableiten? – Wie kann man das Zeichen
„5” aus dem Zeichen
„2 + 3”
ableiten?
| | |
| | | / | | |
Wie verhält es sich denn mit der
Bezeichnung eines ganz bestimmten Tones von Gelb. Da
scheint es doch klar, daß die Wortsprache nicht genügt, jeden
solchen Ton zu beschreiben, obwohl sie sagen kann ein rötliches
oder grünliches Gelb u.s.w.?
Anderseits: Gib diesem Ton einen Namen & er
steht auf gleicher Stufe, ist in keiner anderen Lage als das Wort
„gelb” oder „rot”.
| | |
| | | / | | | Ist es denn
nicht denkbar, daß ein grammatisches System in der Wirklichkeit
zwei (oder mehr) Anwendungen hat?
| | |
| | | / | | | Ja, aber wenn
wir das überhaupt sagen können, so müssen wir die
beiden Anwendungen auch durch eine Beschreibung
unterscheiden können.
| | |
| | | / | | |
Denken wir an zwei Anwendungen des
ˇgrammatischen Farbenschemas, so können wir diese
beschreiben. Aber das Wesentliche dieser
Beschreibung ist, daß sie nur ein neues System
eine neue Multiplizität |
von Zeichen beschreibt & nicht
in irgend einem Sinne mit der Realität anknüpft, in einem
Sinne in welchem das Zeichen mehr als ein Zeichen wäre.
Woher aber
(überhaupt) der Begriff eines
solchen Sinnes?
| | |
| | | / | | |
Woher die Idee daß wir das
Gebiet der Zeichen verlassen könnten?
| | |
| | | / | | | Kommt das nicht daher,
daß wir, wie ich sagen möchte, mit gewissen Zeichen
ganz vertraut sind? Abgesehen von den Sprachen
die wir geläufig sprechen, sind uns viele Gebärden in
diesem Sinne vertraut. Aber worin besteht diese
Vertrautheit?
Ich winke Einem & er
kommt zu mir. Nehmen wir aber an, er verstünde diese
Sprache nicht so leicht[;| ,] nach einer Überlegung
aber deutete er sie doch (richtig), so
hätte er sie in Gedanken in eine Sprache übersetzt die
ihm ist.
| | |
| | | ∫ | | | „Er sagt
mir ‚bringe mir eine
Blume’” Wovon die [b|B]edeutung des Worts
„mir” bestimmt wird. ‒ ‒
| | |
| | | / | | | Ist nicht der
Grund, warum wir glauben, mit der hinweisenden Erklärung
das Gebiet der Sprache, des Zeichensystems, zu verlassen, daß wir
dieses Heraustreten aus den Schriftzeichen mit einer
Anwendung der Sprache, etwa einer Beschreibung dessen was ich sehe,
verwechseln.
| | |
| | | / | | |
Man könnte fragen wollen:
Ist es denn aber ein Zufall daß ich ◇◇◇ zur
Erklärung von Zeichen also zur
Ver[f|v]ollständigung des Zeichensystems aus den
Schrift- oder Lautzeichen heraustreten muß?
Trete ich damit nicht eben in das Gebiet,
sich dann das
Beschriebene
zu beschreibende |
abspielt? Aber dann es
seltsam daß ich überhaupt mit den Schriftzeichen etwas
anfangen kann. – Man faßt es dann
(etwa) so auf, daß die Schriftzeichen
bloß die Vertreter jener Dinge sind auf die man zeigt. – Aber wie seltsam daß so eine Vertretung
möglich ist. Und es wäre nun das Wichtigste
zu verstehen wie denn Schriftzeichen die andern
Dinge vertreten können.
Welche
Eigenschaft müssen sie haben, die sie zu dieser Vertretung
befähigt. Denn ich kann nicht sagen: statt Milch
trinke ich Wasser ˇ& esse statt Brot
esse ich Holz indem ich das Wasser die Milch & das
Holz das Brot vertreten lasse.
⌊⌊
| n.Z. |⌋⌋
Ich kann nun freilich doch sagen daß das
definiendum das definiens vertritt;
& hier seht dieses hinter jenem wie die
Wählerschaft hinter
[dem|ihr]em
Vertreter. [&| Und] in
diesem Sinne kann man auch sagen daß das Er
in der hinweisenden Definition erklärte Zeichen den
Hinweis vertreten kann, da man ja diesen wirklich in einer
Gebärdensprache für jenes setzen könnte.
Aber doch handelt es sich hier um eine Vertretung im Sinne
einer Definition, denn die Gebärdensprache eine Sprache wie jede andere. Und das ist
vielleicht der Succus dieser
Betrachtung
Ich möchte
sagen: Von einem Befehl in der Gebärdensprache zu
seiner Befolgung ist es ebenso weit wie von von diesem
Befehl in der Wortsprache.
| | |
| | | | | | Denn
auch die [H|h]inweisenden Erklärungen müssen ein
für allemal gegeben werden.
| | |
| | | | | | D.h., auch sie gehören
zu dem Grundstock von Erklärungen die den Kalkül vorbereiten
& nicht zu seiner Anwendung ad hoc.
| | |
| | | | | | Denn so sehe ich die Erscheinung einer Sprache:
eine
Sprache: |
daß
man sie lernt (ihre Grammatik, ihr Wörterbuch); &
sie dann spricht.
Oder:
[D|d]aß
es eine Lehre gibt die von ihr handelt & Lehren in denen sie
gesprochen wird.
| | |
| | | / | | |
Die Hi hinweisenden
Erklärungen könnten alle in dem Buch der Sprachlehre gegeben
werden. Sie gehören alle zur Sprachlehre.
| | |
| | | / | | | Mit einem
Draht nach einem Kurzschluß suchen; er ist gefunden wenn es
läutet. Aber suche ich dabei auch nach etwas, was der
Idee des Klingelns gleich ist? usw.
u.sw.
| | |
| | | / | | | Ich kann
doch sagen: „mische die Farben nach denen, die ich
Dir vormale”, aber nicht: „mische Farben nach
den Wörtern, die ich Dir ansage” – wenn diese
Wörter mir nicht schon bekannt sind. – Ich kann
ebenso sagen „Zeichne die Kurven, die ich Dir
vorzeichne”; aber nur in gewissen Fällen:
„Zeichne die Kurven, die ich dir ansage”.
Ist das aber nicht der Fall, den wir hätten,
wenn wir verschiedene complizierte
Wahrheitsfunktionen einerseits mit neuen Namen, anderseits durch die
W-F-Notation
bezeichnen?
| | |
| | | / | | |
„Mische Farben nach den
Wörtern, die ich Dir sage” kommt
naturlich auf dasselbe hinaus
wie: „Mische eine Farbe nach dem Wort
‚A’”
| | |
| | | / | | |
Das heißt doch, eine Farbe, die sich
mit dem Wort ‚A’ rechtfertigen
läßt.
In wiefern läßt sich
denn aber eine Farbe durch eine Farbe
rechtfertigen?
| | |
| | | / | | |
Wir stehen im Kampf mit der
Sprache.
| | |
| | | ∫ / | | |
„Ein Ereignis tritt
ein” „Ein Mensch tritt
ein”
| | |
| | | / | | |
Das ganze Problem der Bedeutung der Worte
ist darin aufgerollt, daß ich den A suche ehe ich ihn
gefunden habe. – Es ist darüber zu sagen, daß
ich ihn suchen kann, auch wenn er in gewissem Sinne nicht
existiert.
Wenn wir sagen, ein Bild ist dazu
nötig, wir müssen in irgend einem Sinne ein Bild von ihm herumtragen, so sage
ich: vielleicht; aber was hat es für einen Sinn zu sagen es
sei ein Bild von ihm. Das hat also auch nur einen
Sinn, wenn ich ein weiteres Bild von ihm habe, das dem Wort
„ihm” entspricht.
| | |
| | | ø | | | Die Lösung
philosophischer Probleme verglichen mit dem Geschenk im Märchen,
das im Zauberberg zauberisch erscheint, & wenn man
es draußen beim Tag betrachtet nichts ist als nur
ein Stück Eisen ist.
| | |
| | | | | | Man sagt etwa: Wenn ich von
der Sonne spreche, muß ich ein Bild der Sonne in mir
haben. – Aber wie kann man sagen daß es ein Bild
der Sonne ist. Hier wird doch die Sonne wieder
erwähnt, im Gegensatz zu ihrem Bilde. Und
damit ich sagen kann: „das ist ein Bild der
Sonne”, müßte ich ein weiteres Bild der Sonne
besitzen. u.s.w.
Zu sagen die Erinnerung ist ein Bild dessen was war, hat nur Sinn,
wenn ich das Wort, was war, diesem Bild
gegen⌊ü⌋berstellen kann & die beiden etwa
vergleichen. Das ist auch möglich, wenn man
unter dem, was war, das Hypothetische versteht, aber nicht, wenn man
darunter eben das versteht was in der Erinnerung gegeben
ist.
| | |
| | | / | | |
Wie seltsam, ich kann ihn suchen, wenn er nicht da ist, aber ich
kann nicht auf ihn zeigen, wenn er nicht da ist. Das ist
eigentlich das Problem des Suchens & zeigt den
irreführenden Vergleich.
Man könnte
sagen wollen: da muß er doch auch dabei sein, wenn ich
ihn suche. – Dann muß er auch dabei sein,
wenn ich ihn nicht finde & auch wenn es ihn nicht
gibt.
| | |
| | | / | | |
Ihn (etwa meinen Stock) suchen, ist eine Art des
Suchens & unterscheidet sich davon, daß man etwas andres
sucht durch das was man beim Suchen tut (sagt, denkt) nicht
durch das, was man findet.
| | |
| | | / | | |
Und trage ich beim Suchen ein Bild mit mir
oder eine Vorstellung, nun gut. Und sage ich das Bild sei
das Bild des Gesuchten, so sagt das nur welchen Platz das Bild im
Vorgang des Suchens einnimmt.
& Und finde ich ihn & sage
„da ist er! den habe ich gesucht”,
so sind die letzten Worte nicht etwa eine Worterklärung
für die Bezeichnung des gesuchten Gegenstandes (etwa
für die Worte „mein Stock”) die erst jetzt
wo er gefunden ist gegeben werden . – Wie man das was man wünscht nach
der Erfüllung des Wunsches nicht besser weiß oder
erklären kann als vorher.
| | |
| | | / | | |
Man kann den Dieb nicht hängen ehe
man ihn hat, wohl aber schon suchen.
| | |
| | | / | | | „Du hast
den Menschen (auf ihn zeigen) gesucht?
Wie war das möglich, er war doch gar nicht
da!”
| | |
| | | / | | |
„Ich suche [M|m]einen
Stock. – Da ist er!” Dies
letztere ist keine Erklarung des
Ausdrucks „mein Stock”, die für das
Verstandnis des ersten Satzes
wesentlich wäre & die ich daher
nicht hätte geben können, ehe mein Stock gefunden
war. Vielmehr muß der Satz „Da ist
er” wenn er nicht eine Wiederholung der ˇauch
früher möglichen Worterklärung ist, ein neuer
synthetischer Satz sein.
| | |
| | | / | | |
Das Problem entspringt einer
Verwechselung eines Wortes oder Ausdrucks mit dem Satz der die
Existenz, das Dasein, des Gegenstands behauptet.
| | |
| | | / | | |
„Den hast Du gesucht? Du
konntest ja nicht einmal wissen, ob er da ist!”
(Vergleiche dagegen das Suchen nach der Dreiteilung des
)
| | |
| | | / | | | Auch haben wir hier die
Verwechslung zwischen der Bedeutung & dem Träger eines
Wortes. Denn der Gegenstand, auf den ich bei dem Worte
„den” zeige ist der Träger des
Namens, nicht seine Bedeutung.
| | |
| | | / | | |
Kurz: ich suche den Träger des
Namens, nicht die Bedeutung des
Namens.
dessen Bedeutung. |
Aber andrerseits: Ich suche
& hänge den Träger des Namens.
| | |
| | | / | | | Man kann von dem
Träger des Namens sagen, daß er (existiert
oder) nicht existiert, & das ist natürlich
keine Tätigkeit, obwohl man es mit einer verwechseln
könnte & sagen, e[s|r] müsse doch dabei
sein, wenn er nicht existiert. (Und das ist von einem
Philosophen gewiß schon einmal geschrieben
worden)
| | |
| | | / | | |
(„Ich suche
ihn.” – „Wie schaut er
aus.” – „Ich weiß es nicht, aber
ˇich bin sicher ich werde ihn wiedererkennen, wenn ich ihn
sehe.”)
| | |
| | | / | | |
4. Man könnte
nur sagen: Wenn er von der Sonne spricht, muß er ein
visuelles Bild (oder Gebilde von der & der Beschaffenheit
– rund, gelb, etc) vor sich
sehen. Nicht, daß das wahr ist, aber es hat Sinn,
& dieses Bild ist dann ein Teil des Zeichens.
| | |
| | | / | | | Ich gehe die
gelbe Blume suchen. Auch wenn mir während des Sehens
ein Bild vorschwebt, brauche ich es denn, wenn ich die gelbe Blume
– oder eine andere – sehe? – Und wenn ich
sage „sobald ich eine gelbe Blume sehe, schnappt, gleichsam, etwas in
dem Gedächtnis
der Erinnerung |
ein”: kann ich denn dieses Einschnappen eher
voraussehen, erwarten, als die gelbe Blume? Ich
wüßte nicht warum. D.h. wenn
es in einem bestimmten Fall wirklich so ist, daß ich nicht die
gelbe Blume sondern ein anderes (indirektes)
Criterium erwarte, so ist
jedenfalls keine Erklärung des
Erwartens.
| | |
| | | / | | |
Aber geht nicht mit dem Eintreffen des
Erwarteten immer ein Phänomen der (oder Befriedigung) Hand in
Hand? Dann frage ich: Ist dieses
Phänomen ein anderes als das Eintreten des
Erwarteten? Wenn ja, dann weiß ich nicht ob so ein
anderes Phänomen die Erfüllung immer begleitet. – Oder ist es dasselbe, wie die Erfüllung?
– Wenn ich sage: Der, dem die Erwartung
erfüllt wird, muß doch nicht sagen „ja, das
ist es” (oder dergleichen), so kann man mir
antworten: „gewiß, aber er muß doch
wissen, daß die Erwartung erfüllt
ist.” – Ja, soweit das Wissen
dazugehört, daß sie erfüllt ist. In
diesem Sinne: wüßte er's nicht, so wäre
sie nicht erfüllt. – „Wohl, aber, wenn
einem eine Er[f|w]artung erfüllt wird, so tritt doch
immer eine Entspannung auf!”
– Woher weißt du das? –
| | |
| | | / | | | Es
ist vielleicht am instruktivsten zu denken, daß, wenn wir mit einem
gelben Täfelchen die Blume suchen, uns jedenfalls nicht die
Relation der Farbengleichheit in einem weiteren Bild gegenwärtig
ist. Sondern wir sind mit dem einen ganz zufrieden.
| | |
| | | / | | | (So wie wir nicht für
einen Augenblick daran dächten, ein Kind die
Gebärdensprache zu lehren.)
| | |
| | | / | | | Wir könnten uns
freilich denken, daß der, welcher mir das gelbe Täfelchen zum
Suchen der Blume gibt, mir dabei auch das Wort
„gleich” erklärte, in
dem er auf farbengleiche Flecken zeigte.
Ja, daß er mir zwei farbengleiche Täfelchen zur
Erinnerung an diese Erklärung mitgäbe, oder aber auf
einem Zettel den Satz „suche eine diesem Täfelchen
gleichfarbige
Blume Und das Wort gleichfärbig
entspräche dann den beiden gleichfärbigen
Täfelchen. Aber: Er hatte mir
also seinen ersten erklärt
& diese Erklärung selbst bestand aus Zeichen
wie der Auftrag & diese Zeichen konnten also weiter
erklärt werden. Jede Erklärung gesellt sich als
Zeichen zu den schon vorhandenen hinzu & gibt nun
eben ein anderes System (eine andere
Multiplizität). (Keine
Erklärung ist daher absolut wesentlich, macht das Zeichen zu
einem Zeichen; & keine ist wesentlich die
letzte.)
| | |
| | | / | | |
Aber konnte denn auch die erste
Erklärung wegbleiben? Gewiß, wenn die Zeichen
 , ⌂, ⊙ uns
(etwa) ursprünglich ebenso
beigebracht worden wären wie die Wörter
„Kirche”, „Haus”,
„Stadt”. Aber diese
wur mußten uns doch erklärt
werden! – Soweit sie uns ˇüberhaupt
„erklärt” wurden, geschah es durch eine
Gebärdensprache die uns nicht erklärt wurde. – Aber wäre denn diese Gebärdensprache einer
Erklarung fähig
gewesen? – Gewiß; z.B. durch
eine Wortsprache. , ⌂, ⊙ uns
(etwa) ursprünglich ebenso
beigebracht worden wären wie die Wörter
„Kirche”, „Haus”,
„Stadt”. Aber diese
wur mußten uns doch erklärt
werden! – Soweit sie uns ˇüberhaupt
„erklärt” wurden, geschah es durch eine
Gebärdensprache die uns nicht erklärt wurde. – Aber wäre denn diese Gebärdensprache einer
Erklarung fähig
gewesen? – Gewiß; z.B. durch
eine Wortsprache.
| | |
| | | / | | |
Freilich kann man sagen: das gelbe
Täfelchen ist in Wirklichkeit auch nicht maßgebend, weil das
Gedächtnis als Kontrolle des Täfelchens verwendet
wird. Aber erstens ist das nicht wahr, wenn wir uns nach
einem ganz bestimmten Farbton richten sollen (dann trauen wir oft
dem Täfelchen & nicht dem Gedächtnis) &
zweitens: Wie ist es mit der Relation zwischen dem was das
Gedächtnis gibt & dem, was ich als ich ihm entsprechend
in der Wirklichkeit anerkenne? Trage ich von dieser
Relation ein Bild herum?
| | |
| | | / | | |
Das Wort
„gegeben”. Damit läßt sich viel
Unfug anstellen. „Nur die Vorstellungen vom Baum
sind mir gegeben, nicht der Baum selbst”.
„Was ich mir [E|e]rwarte ist mir nur
durch Beschreibung
gegeben”. „Davon
Das ist mir nur ˇin
eine⌊r⌋ Beschreibung
gegeben”. –
„Was?!”
Das
hängt unmittelbar mit der Vorstellung des
Satzes zusammen. Denn
ich möchte
fragen: Wie ist mir denn ⌊„⌋das dem Gedächtnis
der
Erinnerung |
in der Wirklichkeit
entsprechende” gegeben?
Das Gedächtnis ist eben ˇselbst eine Sprache.
| | |
| | | / | | | Die Frage
„wie ist mir denn das gegeben” hat Sinn
wenn sie nach der Verification
eines Satzes fr[ä|a]gt um seinen Sinn
deutlich zu machen. So ko
Z.B. können wir sagen
diese Länge
dieses Körpers ist uns durch das Resultat einer Messung
mit dem Maßstab gegeben – nicht durch das Augenmaß.
Die Antwort auf die Frage „wie ist
es mir gegeben” soll also die Bedeutung des
„es” klarer machen, ist also eine grammatische
Erklärung. (Wie ja vorauszusehen war, daß sie
doch gewiß nicht durch einen Versuch zu lösen ist.)
| | |
| | | / | | | Ich habe
oben früher „das was mir das
Gedächtnis gibt” dem entgegengestellt,
„was ich als das ihm in der Wirklichkeit
entsprechende”
anerkenne”. Aber das können doch nur zwei
Symbole einer Sprache sein, &
ˇsolche die sich in einander übersetzen lassen,
wenn sie überhaupt etwas mit einander zu tun haben.
Oder ist es die Erinnerung (oder Erwartung) & die
Erfüllung der Erwartung?
| | |
| | | / | | | Ich wollte oben sagen,
daß das [g|G]edächtnis, auch wenn es zur
Kontrolle des Täfelchens verwendet wird, im gleichen Fall
ist wie das Täfelchen. Daß nämlich auch hier
von einer Interpretation der Re (jener
Relation „des im Gedächtnis
gegebenen zu …”) die Rede sein
könnte & die Frage gefragt werden kann, ob ein Ausdruck dieser
Interpretation dem nach dem Gedächtnis
[s|S]uchenden mitgegeben werden müßte.
| | |
| | | / | | |
Könnte ich behaupten, daß mein Gedächtnis immer
etwas nachdunkle? Jedenfalls könnte ich sagen:
„wähle die Farbe, die Du im Gedächtnis
hast” & auch „wähle deine
eine etwas dunklere Farbe, als die Du im Gedächtnis
hast”.
Von einem Nachdunkeln kann
man natürlich nur im Vergleich zu sprechen & es genügt nicht, zu sagen
„nun, mit der Farbe, „wie sie wirklich
war”, weil hier die besondere Art der
Verification, d.h. die
ˇbesondere Grammatik der Worte „wie sie
war” noch nicht festgelegt ist, diese Worte
(also) noch mehrdeutig sind.
| | |
| | | / | | | Die Frage
aber ist: Ist im Fall einer relativen
Veränderung der Farbe des Täfelchens zu meinem
Gedächtnis (ein gewagter Ausdruck) in irgend einem Sinne
unbedingt der Deutung der Vorzug zu geben, das Täfelchen
habe sich geändert & ich müsse mich also nach dem
Gedächtnis richten? Offenbar nein.
Übrigens besagt die ‚Deutung’, das
Täfelchen & nicht das Gedächtnisbild habe sich
verändert gar nichts als eine Worterklärung der
Wörter „verändern” &
„gleichbleiben”.
| | |
| | | ? / | | | (Über einem
Musikstück steht, vom Komponisten drübergeschrieben
♭ = 88, aber um es heute
richtig zu spielen muß es ♭ = 94 gespielt
werden; welches ist das vom Komponisten gemeinte
Tempo.)
| | |
| | | / | | |
Man könnte auch so sagen:
Wenn meine Absicht dahin geht, etwas dunkleres
oder helleres zu malen (oder zu finden) als
das Täfelchen ◇◇◇ mir zeigt, so ist die Relation des
Gefundenen zum Paradigma keine weniger
als die der
Farbengleichheit. Oder: Wenn der Auftrag
lautet „bringe mir eine dunklere Blume, als dieses
Täfelchen ist”, so spielt bei dem Suchen das
Täfelchen keine andre Rolle (wird nicht
weniger indirekter angewendet) als in dem
früher angenommenen Fall.
| | |
| | | / | | |
Und das zeigt auch, daß das Gedächtnis
die
Erinnerung |
noch einer Interpretation
fähig ist.
Denn, wenn ich sage
„die Blume soll die gleiche Farbe haben, wie die, die Du
im Gedächtnis
hast
jetzt gesehen hast |
”, so zeigt das Wort „gleiche”
schon, wo die Interpretation ansetzen kann.
(Und ich könnte eine Sprache festlegen in der das Weglassen
jeder solchen Bestimmung also „die Blume soll die Farbe
des Täfelchens haben” eben das bedeutet was jetzt der
Satz mit der Bestimmung „dunkler als”
bezei sagt.)
| | |
| | | / | | | Alle Erklärung
scheint hier aufzuhören. Freilich, wir sind ja gar
nicht im Gebiete der Erklärungen.
| | |
| | | / | | | Beim Versteckenspiel
erwarte ich, den Fingerhut zu finden. Wenn ich ihn finde,
gebe ich ein Zeichen der Befriedigung von mir, oder fühle
doch ˇeine Befriedigung. Dieses Phänomen mag
ich auch erwartet haben (oder auch nicht), aber
die⌊se⌋ Erwartung
ist nicht die, den Fingerhut zu finden. Ich kann beide
Erwartungen haben & sie sind offenbar ganz getrennt.
| | |
| | | | | | Ich erwarte mir, eine gelbe
Blume zu finden, dabei schwebt mir das Bild einer gelben Blume
vor. Könnte mir nicht dabei das Bild einer roten Blume
vorschweben – also einer nicht-gelben Blume?
| | |
| | | / | | | Es ist nicht so,
daß wir ein⌊e⌋ Phänomen das
Phänomen einer
Unbefriedigung spüren [ ] , die dann durch finden
des Fingerhutes , & nun sagen: „also
war das jenes Phänomen die
Erwartung den Fingerhut zu
finden
des Fingerhutes |
”
Nein, das
erste Phänomen ist die Erwartung den Fingerhut zu finden
des Fingerhutes |
so sicher,
das zweite das Finden des Fingerhutes ist. Der Ausdruck
„Finden des Fingerhuts”
Das Wort
„Fingerhut” |
gehört zu der
Beschreibung des ersten so notwendig, wie zur Beschreibung des
zweiten. Nur verwechseln wir nicht die „die
Bedeutung des Wortes ‚Fingerhut’”
mit (den Ort dieses Worts im grammatischen Raume)
mit der Tatsache daß ein Fingerhut hier ist.
| | |
| | | / | | | Zu
denken Der Gedanke, daß uns
(erst) das Finden was wir erwartet haben, heißt den Vorgang so
beurteilen wie etwa die Symptome der Erwartung
bei einem Andern. Ich sehe ihn etwa unruhig auf &
ab gehen; da kommt jemand zur Tür herein & er wird ruhig
& gibt Zeichen der Befriedigung; & nun sage
ich: „er hat offenbar diesen Menschen
erwartet”.
| | |
| | | / | | |
Die ‚Symptome der
Erwartung’ sind nicht der Ausdruck der Erwartung.
Und zu glauben, ich wüßte erst nach dem
Finden was ich gesucht (nach der Erfüllung was ich
gewünscht) habe, läuft auf einen unsinnigen
„[B|b]ehaviourism”
hinaus.
| | |
| | | ? / | | |
„Ich wünsche mir eine
gelbe Blume”. – „Ja, ich gehe
& suche Dir eine gelbe Blume”.
Hier habe ich eine gefunden”. –
Gehört die Bedeutung von „gelbe Blume” mehr
zum letzten Satz, als zu den zwei vorhergehenden?
| | |
| | | ∫ | | | Um die Worte, die
die Erwartung beschreiben zu rechtfertigen, könnte ich nur
sagen: Es muß ein Unterschied sein, ob ich eine gelbe
Blume erwarte, oder eine rote, oder eine gelbe Frucht, etc.
| | |
| | | / | | |
Worin besteht das Suchen einer gelben
Blume? Nun, ich gehe umher, sehe mir die Blumen an und
– wenn ich eine gelbe Blume sehe, pflücke ich sie
etwa.
| | |
| | | / | | |
Wir haben uns eben außerhalb (des
Bereichs) aller Erklärung gestellt.
| | |
| | | ? / ∫ | | |
Wir können nur
beschreiben, da uns causale
Zusammenhänge, d.i. die tatsächliche
Folge der Vorgänge, nicht interessiert (da wir
hierin bereit sind, alles zu glauben). Und die
Zusammenhänge, die dann bleiben, sind formelle, die
nicht sich nicht beschreiben lassen, sondern sich in der
Grammatik ausdrücken.
| | |
| | | / ∫ | | |
Worin besteht es, sich eine
gelbe Blume zu wünschen? Wesentlich darin, daß
man in dem, was man sieht, eine gelbe Blume vermißt.
Also auch darin, daß man erkennt, was in dem Satz
ausgedrückt ist „ich sehe jetzt keine gelbe
Blume”.
| | |
| | | / | | |
Dieser Satz ist aus de[m|r]
Betrachten Ansicht hervorgegangen daß der sinnvolle Gebrauch des Ausdrucks
„gelbe Blume” zwar nicht das [s|S]ehen
einer gelben Blume wohl aber die Gegenwärtigkeit des Farbenraumes
voraussetzt. Ich will sagen: wenn ich über
eine gelbe Blume rede, muß ich zwar keine sehen, aber ich muß
etwas sehen & das Wort „gelbe
Blume” hat quasi nur in Übereinstimmung oder im
Gegensatz zu dem Bedeutung was ich sehe. Seine Bedeutung
würde quasi nur von dem aus bestimmt, was ich sehe,
entweder als ⌊das,⌋ was ich sehe, oder als das, was
davon in der & der Richtung so & so weit weg
liegt. Hier meine ich aber weder Richtung
[&|n]och Distanz räumlich im
gewöhnlichen Sinn sondern es kann die Richtung von Rot nach Blau
& die ˇFarben-Distanz von Rot auf ein bestimmtes
Blaurot gemeint sein. – Aber auch so stimmt meine
Auffassung nicht. Es ist schon richtig daß der Satz
„ich wünsche eine gelbe Blume” den Gesichtsraum
voraussetzt nämlich ˇnur in sofern als er in unserer Sprache voraussetzt
daß der Satz „ich sehe jetzt eine gelbe Blume”
& sein Gegenteil Sinn haben muß. Ja es muß
auch Sinn haben, oder vielmehr, es hat auch Sinn zu sagen
„das Gelb was ich mir wünsche ist grünlicher als
das welches ich sehe”. Aber anderseits wird der
grammatische Ort nic des Wortes
„gelbe Blume” nicht durch eine Maßangabe bezogen
auf das was ich jetzt sehe bestimmt. Obwohl, soweit von
einer solchen Entfernung & Richtung die Rede überhaupt
sein kann, durch die Beschreibung des gegenwärtigen
Gesichts-bildes & des
gewünschte⌊n⌋ diese Entfernung
& Richtung im grammatischen Raum gegeben sein muß.
| | |
| | | ? / | | | Die
Bedeutung des Wortes „gelb” ist nicht die Existenz
eines gelben Flecks: Das ist es, was ich über das
Wort Bedeutung sagen möchte.
| | |
| | | ∫ | | | Wie ist es
hiermit: „A” bedeutet die Richtung
→,
„B” die Richtung ←
| | |
| | | ∫ | | |
Seltsame Aufschrift für ein Buch:
„Dieses Buch darf nur in diesem Raum gelesen
werden.” (Daran ließe sich
[v|V]ieles erklären.)
| | |
| | | / | | | Was die Erklärung des
Pfeiles betrifft, so ist es klar, daß man sagen kann:
„Dieser Pfeil nicht,
daß Du dorthin (mit der Hand zeigend) gehen sollst, sondern
dahin.” – Und es ist klar daß ich
würde diese Erklärung natürlich verstehen. – ⌊
„Das müßte man
(aber) dazuschreiben”.
⌋
| | |
| | | ∫ | | | Jene
Aufschrift für ein Bibliotheksbuch & die Bemerkung, die
ich einmal wirklich unter einer Zimmerordnung gelesen habe:
„[d|D]iese Regeln dürfen nicht
übertreten werden” sind ebenso wirkungslos,
wie eine Maschine die mein Vater einmal erfunden hat
hat & deren Wirkungslosigkeit er zuerst nicht
. Es sollte
eine Straßenwalze sein. Der Arbeitszylinder ist im
Inneren der Walze befestigt &
 so ist
natürlich das ganze ein starres System, dessen Teile sich
gegen einander nicht rühren
können. Und anderseits kann man es auf der Straße hin & her rollen wie
man will & es so ist
natürlich das ganze ein starres System, dessen Teile sich
gegen einander nicht rühren
können. Und anderseits kann man es auf der Straße hin & her rollen wie
man will & es stimmt
immer
erlaubt alles |
. Ich will sagen: was immer man mit
der Walze tut, ist dem Innern dieser Walze recht. (Und
hier liegt die Analogie.)
| | |
| | | / | | |
5. Unmittelbare
Erfahrung (Sinnes-Datum) ist entweder ein Begriff von
trivialer Abgrenzung oder eine Form.
| | |
| | | ∫ | | | Ich könnte der
Erklärung des Pfeiles der Vorstellung
folgen. Das wäre so, als folgte ich ihr mit einer
Zeichnung (& hier handelt es sich ja um das
„Primäre” der Zeichnung, nicht um das
Physikalische. Dann aber scheint die Vorstellung noch eine
andere Rolle zu spielen, in der sie scheinbar nicht
interpretierbar ist. Nicht interpretierbar, weil
schon interpretiert, oder eigentlich, weil schon Zeichen &
Interpretation. Aber wie interpretiert man denn
Zeichen? Doch durch andre Zeichen. [ Doch, indem man sie mit andern Zeichen
verbindet. ]
| | |
| | | / ∫ | | |
Ich will doch sagen:
Die ganze Sprache kann man nicht interpretieren.
| | |
| | | / | | | Eine
Interpretation ist immer nur eine im Gegensatz zu einer
[A|a]ndern. Sie hängt sich an das
Zeichen & reiht es in ein weiteres System ein.
| | |
| | | / | | | Wenn
Ist es nun notwendig zur Interpretation,
Erklärung, des Wortes ‚gelb’ auf einen gelben
Gegenstand zu zeigen? Könnte man nicht
z.B. auf einen blauen zeigen mit
den Worten „das ist gelb”, auf einen
grünen & sagen „das ist rot” u.s.w. immer auf den Namen
der
Complementärfarbe nennend. Daß
dadurch ein Mißverständnis hervorgerufen
würde ist zwar klar aber wäre diese Erklärung nicht im
gleichen Fall wie etwa die: Es zeigt einer mit dem Finger
in eine Richtung & sagt das ist ‚rot’
& dadurch die
Farbe des Gegenstandes der in der entgegengesetzten Richtung
liegt. Auch diese Erklärung würde
Mißverständnisse hervorrufen wäre aber so
einwandfrei wie der Zeiger einer Uhr der so
 auf 6
zeigt. auf 6
zeigt.
| | |
| | | ∫ | | |
Man verwechselt so leicht das gemalte Bild
im physikalischen Sinn mit dem entsprechenden Gesichtsbild.
Dieses kann sehr wohl statt des Erinnerungsbildes stehen;
warum denn nicht. Wenn man fühlt, daß das nicht
möglich ist, denkt man an das physikalische
[b|B]ild.
| | |
| | | / | | |
Es ist also richtig:
„Ich erinnere mich daran
↗
ˇan das was ich hier vor mir sehe”. Das Bild
ist dann in einem gewissen Sinne gegenwärtig &
vergangen.
| | |
| | | / | | |
Der Vorgang des
Vergleich[s|e]s
eines Bildes mit der Wirklichkeit ist also der Erinnerung nicht
wesentlich.
| | |
| | | ? / | | |
Wenn man mir sagt „bringe
eine gelbe Blume” & ich stelle mir vor, wie ich eine
gelbe Blume hole, so habe ich bewiesen, daß ich den Befehl
verstanden habe. Aber ebenso, wenn ich ein Bild des
Vorgangs malte. – Warum?
Wohl, weil das, was ich tue mit Worten des Befehls beschrieben
werden muß. Oder soll ich sagen, ich habe
tatsächlich einen (dem ersten)
verwandten Befehl ausgeführt.
| | |
| | | / | | |
Warum sieht man es als einen Beweis
dafür an daß ein Satz Sinn hat, daß ich mir, was er sagt
vorstellen kann? Weil ich diese Vorstellung mit
einem dem ersten verwandten Satz beschreiben
müßte.
Ich habe ja
damit nur den Satz in einem primitiveren ⌊⌊Symbolismus
wiederholt.⌋⌋
| | |
| | | / | | |
Ist aber kein
Unterschied zwischen Bild & Bild? Symbol &
Symbol?
| | |
| | | / | | |
”Ich stelle mir vor wie das sein
wird” (Wenn der Sessel weiß
gestrichen sein wird) – Wie kann ich es
mir denn [v|V]orstellen, wenn es nicht
ist?! Ist denn die Vorstellung eine
Zauberei? Nein, die Beschreibung der Vorstellung
ist (ja) nicht dieselbe, wie die
Beschreibung des erwarteten Ereignisses.
| | |
| | | ∫ | | | „Du sagtest
mir ‚geh aus dem Zimmer’, darum tat ich
das” (und nun zeichnet er den Vorgang auf, oder
macht ihn vor). Aber da ist ja scheinbar gar kein
Zusammenhang!
| | |
| | | / | | |
Wie kann man kalkulieren, daß
3 + 2 = 5
ist?! da doch ‚5’ zu
‚3 + 2’ keine
interne Beziehung hat? Es geht auch nur auf einem Weg,
der diese Beziehung herstellt.
| | |
| | | / | | |
Der Satz ist der Tatsache so ähnlich,
wie das Zeichen ‚5’ dem Zeichen
‚3 + 2’.
Und das gemalte Bild der Tatsache, wie
‚❘ ❘ ❘ ❘ ❘’
dem Zeichen ‚❘ ❘ + ❘ ❘ ❘’.
| | |
| | | ? / ∫ | | |
Wenn man sagt:
Ich stelle mir die Sonne vor, wie sie rasch über den Himmel
zieht; so ist doch nicht die Vorstellung damit beschrieben, daß
„die Sonne rasch über den Himmel
zieht”! Nun könnte ich einerseits fragen: ist nicht,
was Du vor Dir siehst etwa eine gelbe Scheibe in
Bewegung[,| ?] aber doch nicht gerade die
Sonne[?| .] –
[a|A]ndrerseits, wenn ich sage „ich
stelle mir die Sonne in dieser
Bewegung
so & so |
vor”, so ist das nicht dasselbe, wie wenn ich
(etwa kinematographisch) ein solches Bild zu sehn
bekäme.
Ja es hatte Sinn von diesem
Bild zu fragen: „stellt das die Sonne
vor?”
| | |
| | | ∫ | | |
Nehmen wir an, es
gabe zwei Sonnen I & II am
Himmel die gleich aussähen, & nun sagt einer:
„ich stelle mir die Sonne I in einer solchen Bewegung
vor”. Könnte man ihn da fragen:
„Woher weißt du daß es
(geradec) die Sonne
I ist”? Der Unterschied kann in
nichts liegen, was an der Vorstellung einem gemalten Bild
vergleichbar ist.
| | |
| | | / | | |
Über das Vorstellen als Beweis des
Sinnes: Wenn es Sinn hat zu sagen „ich kann mir
vorstellen daß p der Fall ist”, so hat es auch Sinn
zu sagen „p ist der Fall”.
| | |
| | | / ? ∫ | | |
Die Vorstellung in
dem Sinn, in dem ich früher von ihr gesprochen habe, ist wie ein
Bild mit der Überschrift „Bildnis des N.N.”.
| | |
| | | ∫ | | | Mein Gehirn wird wohl
einmal gleichsam vor Alter erblinden. Aber nicht
unbedingt erst, wenn ich viel älter bin als
jetzt.
| | |
| | | / | | |
Was heißt es denn
„entdecken daß ein Satz Sinn
hat”? Oder fragen wir so: Wie kann
man denn die Unsinnigkeit eines Satzes (etwa: „dieser
Körper ist ausgedehnt”) dadurch bekräftigen,
daß man sagt: „Ich kann mir nicht vorstellen,
wie es anders wäre”?
Denn kann ich etwa versuchen, es mir
vorzustellen? Heißt es nicht: Zu sagen,
daß ich es mir vorstelle, ist sinnlos? Wie hilft mir
dann also diese Umformung von einem Unsinn in einen
andern? – Und warum sagt man gerade:
„ich kann mir nicht vorstellen, wie es anders
wäre”? und nicht – was doch auf dasselbe
hinauskommt – „ich kann mir nicht vorstellen, wie das
wäre”?
Man anerkennt
scheinbar in dem unsinnigen Satz etwas wie eine Tautologie zum
Unterschied von einer
Contradiction.
Aber das ist ja auch falsch. – Man sagt
gleichsam: „Ja, ist
ausgedehnt, aber wie könnte es denn anders sein? also wozu
es sagen”.
Es ist dieselbe Tendenz
die uns auf den Satz „dieser Stab hat eine bestimmte
Länge” nicht antworten läßt
„Unsinn!”, sondern:
„Freilich!”.
Was ist
aber der Grund (zu) dieser
Tendenz? Sie könnte auch so beschrieben
werden: Wenn wir die beiden Sätze „dieser
Stab hat eine Länge” & seine Verneinung
„dieser Stab hat keine Länge” hören, so
sind wir parteiisch & neigen dem ersten Satz zu
(statt beide für Unsinn zu erklären).
Der Grund hiervon ist aber eine
Verwechslung: Wir sehen den ersten Satz
verifiziert (und den zweiten falsifiziert) dadurch,
„daß der Stab 4 m hat”. Und
man wird sagen: „und 4 m ist doch eine
Länge” und vergißt daß man hier einen Satz der
Grammatik hat.
| | |
| | | | | | Wenn man manchmal sagt:
man könne das Helle nicht sehen, wenn man nicht das Dunkle
sähe; so ist das kein Satz der Physik oder Psychologie –
denn hier stimmt es nicht & ich kann sehr wohl eine
ganz weiße Fläche sehen & nichts
[d|D]unkles daneben – sondern es muß
heißen: Es hat keinen Sinn in unserer Sprache von
Helligkeit zu reden, wenn es nicht Sinn hat, von etwas Dunklem zu
reden.
| | |
| | | / | | |
Was heißt es denn „entdecken
daß ein Satz keinen Sinn hat”?
Und was heißt das: „Wenn ich etwas damit
meine muß es doch Sinn haben”?
„Wenn ich etwas damit meine …” – wenn
ich was damit meine?!
| | |
| | | | | | Was heißt es: „Wenn ich mir
etwas dabei vorstellen kann, muß es doch Sinn
haben”?
Wenn ich mir was
dabei vorstellen kann? Das was ich ? – Dann heißt dieser Satz nichts
Das heißt nichts |
. – Und
‚Etwas’? Das würde
heißen: wenn ich die Worte auf diese Weise
benützen kann, dann haben sie Sinn. Oder
eigentlich: wenn ich sie zum Kalkulieren
benütze, dann haben sie Sinn.
| | |
| | | / | | | (Philosophie
versteht niemand: Entweder er versteht nicht,
was geschrieben ist, oder er versteht
es, : aber sieht nicht, daß es
Philosophie ist.)
| | |
| | | | | |
„Du hast mit der Hand eine Bewegung gemacht; hast Du
etwas damit gemeint? – Ich dachte, Du meintest, ich
solle zu Dir kommen”.
| | |
| | | / | | | Die Frage ist ob man
fragen darf „was hast Du gemeint”.
Auf diese Frage (aber)
kommt ein Satz zur Antwort. Während, wenn man so nicht
fragen darf, das Meinen – sozusagen – amorph
ist. Und „ich meine etwas mit dem Satz”
ist dann von der selben Form wie
„ Satz ist nützlich”,
oder „dieser Satz greift in mein Leben ein”.
| | |
| | | ? / | | |
Wenn man nun fragt „hast Du etwas mit dieser Handbewegung
gemeint””?, so kann die Antwort
sein „nein ich hab' gar nichts damit
gemeint” oder „ja, ich habe etwas
gemeint”. Und in diesem Fall wird man fragen
„was?” und die Antwort werden etwa Worte
sein
| | |
| | | / | | |
Könnte man aber antworten:
„ich habe etwas mit dieser Bewegung gemeint, was ich nur
durch sie diese Bewegung ausdrücken
kann”?
| | |
| | | / | | |
Ich scheine sagen zu wollen:
Verstehen, heißt nur, eine
Art ˇvon Zeichen zu erfassen (zu erhalten).
| | |
| | | / | | |
„Nein ich hab' gar nichts mit dieser
Bewegung gemeint. Ich hab' sie ganz
unwillkürlich gemacht”. Oder
aber: „Ja, ich habe etwas gemeint, ich wollte,
daß Du kommst”.
Aber dann
wa[s|r] dieses Wollen daß der Andre kommen soll ein
besonderer Vorgang. Da[ß|s] heißt, ich
habe jetzt den ganzen Vorgang in den Satz übersetzt „ich
wollte, daß Du kommst”. Aber er war nun doch
wieder nur ein Zeichen.
| | |
| | | / | | |
Auf die Frage „was
meinst Du” müßte die Antwort die
Erklärung des Zeichensystems sein, zu dem das
gegebene Zeichen gehört. – Und durch die
Antwort „ich meine, daß Du kommen sollst”
ist ja auch nur ˇeben das getan, denn das Zeichen wurde jetzt
in einen Satz einer uns bekannten Sprache übersetzt.
Und eine Sprache ist uns nur verständlich weil wir sie,
ihr System, kennen. Denn alle Erklärung kann nichts
tun als uns die Sprache kennen lehren.
| | |
| | | / | | | Aber dieser ˇletzte
Satz ist mit Vorsicht
aufzufassenzunehmen. Denn kann man sagen, wir
verstünden die Gebärdensprache, weil wir ihr System
kennen? Ja & [N|n]ein.
| | |
| | | / | | | Der Vorgang
könnte auch so sein, daß nach der Antwort „ja, ich
habe etwas mit der G Bewegung gemeint”
& der Frage „was?” die Antwort
: „Ich
brauch' es nicht zu sagen,
„Du
weißt's schon, |
Du verstehst mich
schon”.
Und diese Antwort zeigt am
klarsten das Wesen des Verstehens, denn wenn nun dem der
Ander[en|e] auf einmal versteht, was gemeint war, so
sieht er in dem Zeichen jetzt eines im Gegensatz zu
anderen. Wenn er es nun deutet so deutet er es so
im Gegensatz zu anders.
| | |
| | | ∫ | | |
„Ach ja, ich wußte nicht, wohin
Du zeigtest zeigst; daß Du auf den
zeigst!”
| | |
| | | | | | Die
Erklärung:
„[h|H]ast
Du mich denn nicht verstanden; ich habe auf ihn
gezeigt” erklart ein System, denn
erklärt aus welchem Gesichtspunkt ich das
Zeichen hätte auffassen sollen. „Schau doch, auf wen
!”
| | |
| | | / | | | Ich bin nun
immer zu dem Fehler geneigt zu glauben ein System könnte
außerhalb seines Ausdrucks, in der Grammatik etwa,
existieren.
| | |
| | | / | | |
„Jetzt sehe ich's erst,
er zeigt immer auf die Leute die dort
vorübergehen”. Er hat ein System
verstanden: wie einer dem ich die Ziffern 1, 4, 9, 16 zeige
& der sagt „ich versteh' jetzt das System
ich kann jetzt selbst weiter schreiben”.
Aber was ist diesem Menschen geschehen als er das System
plötzlich verstand? Ist es etwas anderes als daß
ihm die Variable „x²” oder ein
analoges Zeichen eingefallen ist?
| | |
| | | / | | | Man wird vielleicht
sagen: „ganz richtig es ist ihm
x² die Form
x² eingefallen, aber
im Gegensatz zu x³ oder
x(”.
Aber was heißt es denn „im Gegensatz
zu …” Dieser Gegensatz steht vielleicht in einem
Buch, oder kommt durch einen
weiteren
Schritt zu Tage. Kurz die Entwickelung des
Systems geschieht in der Zeit (und im Raum des
Buches)
| | |
| | | / | | |
Was dem Können in „ich kann
jetzt selbst weiterschreiben” zu Grunde liegt ist auch nur der Einfall des
Variablen-Ausdrucks (also eines
Zeichen, wieder nur eines Steins im
Kalkül welches selbst sich in der Zeit entfaltet) & etwa das
Ausrechnen „im Kopf” von einigen weiteren Zahlen
einer Zahl von
Resultaten |
.
| | |
| | | / | | | Es handelt
sich ˇbeim Verstehen nicht um einen Akt des momentanen,
sozusagen nicht diskursiven, erfassens der
Grammatik. Als könnte man sie gleichsam auf
einmal herunterschlucken.
| | |
| | | | | |
Das also, was der macht, der auf einmal die Bewegung des Andern
deutet (ich sage nicht „richtig deutet”) ist
ein Schritt in einem Kalkül. Er tut
ungefähr was er sagt wenn er seinem
Verstandnis Ausdruck gibt. –
Und das ist ja immer unser –. Und wenn ich sage „was er
macht ist der Schritt eines Kalküls” so heißt das,
daß ich diesen Kalkül schon kenne; in dem Sinne in dem ich die
deutsche Sprache kenne oder das Einmaleins.
Welche ich ja auch nicht so in mir ˇhabe als wäre die
ganze deutsche Grammatik & die Einmaleins-Sätze
zusammengeschoben auf Etwas was man ich
mit nun auf einmal, als Ganzesc,
erfassen kann besitze.
| | |
| | | / | | |
Ich fasse das Verstehen also, in
irgendeinem Sinne, behaviouristisch auf.
| | |
| | | ? / | | |
‚Sprache’ nenne ich nur das, wovon sich
eine Grammatik schreiben läßt.25
| | |
| | | ? / | | |
‚Kalkül’26 nur
wovon sich ein Regelverzeichnis anlegen läßt.
| | |
| | | / | | | Gewiß,
der Vorgang des „Jetzt versteh ich
…!” ist ein ganz spezifischer, aber
es ist eben auch ein ganz spezifischer Vorgang,
wenn wir auf einen ˇbekannten
Kalkul stoßen, wenn wir
„weiter wissen”.
Aber
dieses Weiter-Wissen ist eben auch diskursiv
(nicht intuitiv).
(Und es kommt eben hier heraus, was ich vor langer Zeit
aufgeschrieben habe, daß wir nämlich „von
Büchern” ˇ& derlei Dingen reden
müssen &
nicht von einem sprachlichen Wolkenkuckucksheim.)
| | |
| | | | | | Das
behaviouristische an meiner
Auffassung unserer Behandlung besteht nur darin,
daß ich wir keinen Unterschied zwischen
‚außen’ & ‚innen’
machen. Weil
die Psychologie nichts angeht.
| | |
| | | ø \ | | | 6. Ich glaube, das
Charakteristische des primitiven Menschen ist es, daß er nicht aus
Meinungen handelt (dagegen
Frazer). Ich
lese unter vielen ähnlichen Beispielen von einem
Regen-König in Afrika zu dem die Leute um Regen
bitten wenn die Regenperiode kommt. Aber
das heißt doch daß sie nicht eigentlich meinen er könne
Regen machen, sonst würden sie es in den trockenen Perioden
des Jahres in der das Land „a parched and arid
desert” ist, machen. Denn wenn man annimmt
daß die Leute einmal aus Dummheit dieses Amt des Regenkönigs
eingesetzt haben so ist es doch gewiß klar daß sie schon
vorher die Erfahrung hatten, daß im März der Regen
beginnt & sie hätten dann den Regenkönig für
den übrigen Teil des Jahres funktionieren lassen. Oder
auch so: Gegen morgen, wenn die Sonne aufgehen will werden
von den Menschen Riten des Tagwerdens
celebriert aber nicht in der Nacht, sondern da
brennen sie einfach Lampen.
| | |
| | | ø \ | | |
Wenn ich
über etwas wütend bin so sch⌊l⌋age ich manchmal mit
meinem Stock auf die Erde oder an einen Baum etc. aber
ich glaube doch nicht daß die Erde [S|s]chuld
ist oder das Schlagen etwas helfen kann.
„Ich lasse meinen Zorn aus”
Und dieser Art sind alle Riten. Soche
[h|H]andlungen kann man Instinkt -Handlungen nennen. – Und eine historische Erklärung etwa daß ich
früher oder meine Vorfahren früher geglaubt haben das
Schlagen der Erde f helfe etwas sind
Spiegelfechtereien denn sie sind überflüssige
Annahmen die nichts erklären. Wichtig
ist die Ähnlichkeit des Aktes mit einem Akt der Züchtigung
aber mehr als diese Ähnlichkeit ist nicht zu
konstatieren.
Ist ein solches ⋎
Phänomen einmal mit einem Instinkt den ich selber besitze
in Verbindung gebracht so ist eben dies die
Erklärung; d.h. die welche diese besondere
Schwierigkeit
das
besondere puzzlement |
löst. Und eine
weitere Forschung
Betrachtung |
über die
Geschichte meines Instinkts bewegt sich nun auf andern
Bahnen.
| | |
| | | ø \ | | |
Kein geringer
Grund d.h. überhaupt kein Grund
kann es gewesen sein was gewisse Menschenrassen den Eichbaum verehren
ließen, sondern nur da[ß|s], daß sie
& die Eiche in einer Symbiose
Lebensgemeinschaft |
vereinigt waren also nicht aus
[w|W]ahl sondern wie der Floh mit dem
& der Hundˇ in ihrer Entstehung vereinigt.
¤ (Entwickelten die Flöhe
einen Ritus, er würde sich auf den Hund
beziehen)
¤ [ miteinander
entstanden. ]
| | |
| | | ø \ | | |
Man könnte sagen nicht ihre Vereinigung (von Eiche
& Mensch) hat zu diesen Riten die Veranlassung
gegeben, sondern vielleicht ihre Trennung [ sondern, in gewissem Sinne, ihre
Trennung ]
| | |
| | | ø \ | | |
Denn das Erwachen
des Intelekts geht mit einer Trennung von dem
ursprunglichen Boden der
ursprunglichen Grundlage des Lebens
vor sich. (Die Entstehung der
Wahl.)
| | |
| | | ø \ | | |
(Die Form des
erwachenden Geistes ist die Verehrung.)
| | |
| | | ? / | | |
„Ist die Vorstellung nur die Vorstellung, oder ist die
Vorstellung von Etwas in der Wirklichkeit?”
„Ist die Vorstellung nur die Vorstellung,
oder ist die Vorstellung in Bezug Beziehung auf
die Wirklichkeit?”
„Ist
die Vorstellung nur die Vorstellung, oder ist sie Vorstellung von
Etwas in der Wirklichkeit?”
| | |
| | | ? / | | | Und von dieser
Frage könnte man auch die Beziehung z der
Vorstellung zum gemalten Bild erfassen.
| | |
| | | ? / | | | Die Frage
könnte aber nicht heißen: „Ist die
Vorstellung immer Vorstellung von etwas, was in der Wirklichkeit
existiert” – denn das ist sie offenbar nicht immer
–; sondern, es müßte heißen: bezieht sich
die Vorstellung immer, wahr oder falsch, auf Wirklichkeit. – Denn das kann man von einem gemalten Bild nicht
sagen. –
| | |
| | | | | | Aber warum
sollte man dann nicht sagen, daß Vorstellung eine Vorstellung eines Traumes
sei?
| | |
| | | ? / | | |
Verhalten sich nicht Vorstellung
& Wirklichkeit zu einander wie ein
ebenes Bild zum dreidimensionalen Raum? in immer etwas existieren kann, dessen
Projection das ebene Bild ist?
(Also doch wohl wie die Sprache zur Wirklichkeit
im Raum.)
| | |
| | | | | |
… quia plus loquitur
inquisitio quam inventio …
(Augustinus)
| | |
| | | / | | |
Manifestissima & usitatissima sunt, & eadem
rursus nimis latent, & nova est inventio eorum.
(Augustinus)
| | |
| | | | | | Wenn man sagt, Vorstellungen seien
privat, so ist man wieder von einer
falschen Analogie irregeleitet.
| | |
| | | | | | Könnte ich malen, daß es sich so
verhält, wenn es keinen Sinn hätte, zu sagen
„es verhält sich so”?
Aber dieser Ausdruck „malen, daß es sich so
verhält” ist selbst problematisch. Er
trägt bereits eine Deutung in das Bild hinein.
| | |
| | | / | | |
Man wird
sagen: der Maler der „Malheurs de
Chasse” hat
nicht gemeint daß es wirklich so zugeht; hätte
er es aber seine Bilder lehrhaft (um zu zeigen wie es
zugeht) gemeint, so wäre er im Unrecht
gewesen.”
| | |
| | | / | | |
Aber dasselbe gilt doch auch von
Erzählungen etwa des Baron
Münchhausen.
In dem Sinn in welchem man von ihnen sagen
kann sie seien nicht wahr kann man es allerdings auch von irgend einem
Bild sagen das keine historische
darstellen soll.
| | |
| | | / | | |
Anderseits kann man von jenen
Erzählungen insofern nicht sagen sie seien unwahr
als sie gar nicht auf eine Methode der
Verification deuten. (Ebenso
wie ein Genrebild.)
12672
150
27
| | |
1) Continuation from Ms-109,271.
2) See facsimile; line connecting this remark with the following one.
3) Continuation in Ms-109,272.
4) Continuation from Ms-109,300.
5) See facsimile; line connecting this remark with the following one.
6) See facsimile; line connecting this remark with the following one.
7) See facsimile; line connecting this remark with the following one.
8) See facsimile; line connecting this remark with the following one.
9) See facsimile; line connecting this remark with the following one.
10) See facsimile; line connecting this remark with the following one.
11) See facsimile; line connecting this remark with the following one.
12) See facsimile; line connecting this remark with the following one.
13) See facsimile; line connecting this remark with the following one.
14) See facsimile; line connecting this remark with the following one.
15) See facsimile; line connecting this remark with the following one.
16) See facsimile; line and an arrow connecting this remark with the following one.
17) See facsimile; line connecting this remark with the following one.
18) Digit "1" inserted above "rote".
19) Digit "2" inserted above "rot".
20) See facsimile; line connecting this remark with the following one.
21) See facsimile; line connecting this remark with the following one.
22) See facsimile; line connecting this remark with the following one.
23) See facsimile; line connecting this remark with the following one.
24) See facsimile; line connecting this remark with the following one.
25) See facsimile; line connecting this remark with the following one.
26) See facsimile; there seems to be an arrow pointing up.
27) Continuation in Ms-111,1.
 versteht, muß, oder müßte, den Befehl
versteht, muß, oder müßte, den Befehl
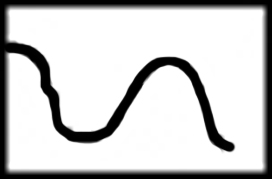 verstehen.
Aber was heißt das „er müßte”.
Das muß offenbar eine Beschreibung dessen sein, was beim
Verstehen des ersten Befehls vorsichgeht. Es war eine Beschreibung dessen was er in
jenem Befehl sieht [ … eine Beschreibung davon,
wie er jenen Befehl auffaßt ]
verstehen.
Aber was heißt das „er müßte”.
Das muß offenbar eine Beschreibung dessen sein, was beim
Verstehen des ersten Befehls vorsichgeht. Es war eine Beschreibung dessen was er in
jenem Befehl sieht [ … eine Beschreibung davon,
wie er jenen Befehl auffaßt ]  stellt eine Hand vor, oder: ich verstehe es als Hand, so sage
ich etwas über den Eindruck den das Zeichen
macht. Es ist aber doch keine Hand, noch ist eine
wirkliche Hand im Spiele & wenn ich sage es erinnert mich an
eine Hand, so heißt das, es ruft Vorstellungen,
Empfindungen in mir wach [ … es verursacht in mir
Vorstellungen, Empfindungen, etc ] in denen eine Hand nicht
vorkommt. Heißt das nun also, daß ich diese
Vorstellungen etc. auch anders ohne
Erwahnung der Hand hätte beschreiben
können, und die Anspielung auf die Hand
stellt eine Hand vor, oder: ich verstehe es als Hand, so sage
ich etwas über den Eindruck den das Zeichen
macht. Es ist aber doch keine Hand, noch ist eine
wirkliche Hand im Spiele & wenn ich sage es erinnert mich an
eine Hand, so heißt das, es ruft Vorstellungen,
Empfindungen in mir wach [ … es verursacht in mir
Vorstellungen, Empfindungen, etc ] in denen eine Hand nicht
vorkommt. Heißt das nun also, daß ich diese
Vorstellungen etc. auch anders ohne
Erwahnung der Hand hätte beschreiben
können, und die Anspielung auf die Hand
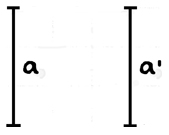 darin, daß
a, in die allgemeine Disposition eingesetzt, a'
ergibt.
darin, daß
a, in die allgemeine Disposition eingesetzt, a'
ergibt.  nach dem Pfeil
↗
nach dem Pfeil
↗
 Wie verhalt sich nun das Wesen
der einer
Wie verhalt sich nun das Wesen
der einer  als eine Variante
von
als eine Variante
von  , nicht von
, nicht von
 . Der
Unterschied von eis und fin der
Musik ⌊.⌋
. Der
Unterschied von eis und fin der
Musik ⌊.⌋  , ⌂, ⊙ uns
(etwa) ursprünglich ebenso
beigebracht worden wären wie die Wörter
„Kirche”, „Haus”,
„Stadt”. Aber diese
wur mußten uns doch erklärt
werden! – Soweit sie uns ˇüberhaupt
„erklärt” wurden, geschah es durch eine
Gebärdensprache die uns nicht erklärt wurde. – Aber wäre denn diese Gebärdensprache einer
Erklarung fähig
gewesen? – Gewiß; z.B. durch
eine Wortsprache.
, ⌂, ⊙ uns
(etwa) ursprünglich ebenso
beigebracht worden wären wie die Wörter
„Kirche”, „Haus”,
„Stadt”. Aber diese
wur mußten uns doch erklärt
werden! – Soweit sie uns ˇüberhaupt
„erklärt” wurden, geschah es durch eine
Gebärdensprache die uns nicht erklärt wurde. – Aber wäre denn diese Gebärdensprache einer
Erklarung fähig
gewesen? – Gewiß; z.B. durch
eine Wortsprache.  so ist
natürlich das ganze ein starres System, dessen Teile sich
gegen einander nicht rühren
können. Und anderseits
so ist
natürlich das ganze ein starres System, dessen Teile sich
gegen einander nicht rühren
können. Und anderseits  auf 6
zeigt.
auf 6
zeigt.